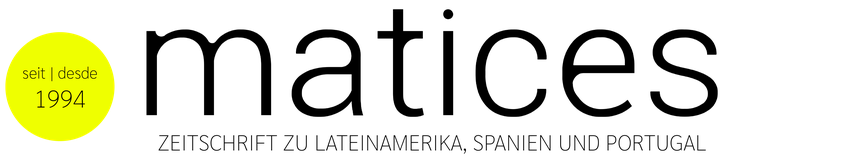„Widerstand bedeutet, den Kopf oben zu behalten“
Kampf um Freiräume und Selbstbehauptung in Mexiko
Interview von Judith De Santis
In einem Land wie Mexiko existieren Gewalt und Schönheit nebeneinander. Krasse Gegensätze bestimmen den Alltag, der oft schwer zu bewältigen ist. Wie schaffen es die Menschen dennoch, sich herrschenden Strukturen zu widersetzen? Die Journalistin Alexandra Endres hat eine zweimonatige Reise durch Mexiko unternommen, um diese Menschen zu treffen und ihre Geschichten zu hören. In ihrem neuen Buch zu Mexiko erzählt sie von Mut und Widerstandskraft und erklärt dabei die aktuellen Themen und Konflikte des Landes.
Frau Endres, ist das Leben in Mexiko so gefährlich, wie es viele deutsche Medien berichten?
Ich selbst habe in Mexiko ja nicht im Alltag gelebt, sondern war die ganze Zeit auf Reisen. Deshalb kann ich die Frage gar nicht richtig beantworten. Und Medienberichte geben immer nur einen Ausschnitt der Realität wieder. Trotzdem habe ich dort manche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die ich in Deutschland so nicht treffen würde. Das ist erst mal ganz unspektakulär. In Mexiko-Stadt habe ich zum Beispiel versucht, nachts nur auf hell beleuchteten Wegen zu Fuß unterwegs zu sein. Viele Frauen sagten mir, dass sie eigentlich immer vorsichtig sein müssen, dass sie beispielsweise nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein können, ohne Angst zu haben, dass sie jemand betatscht oder anmacht. Das ist ja auch eine Form von Gewalt. Und wenn man sich ein bisschen länger mit den Leuten unterhält, hört man erstaunlich oft solche Geschichten. Auf den ersten Blick sind unangeneh- me Begegnungen in der U-Bahn natürlich nichts im Vergleich zu den krassen Mordfällen, von denen man aus den Medien erfährt. Aber vielleicht hängt beides, die alltägliche Belästigung und die extreme Gewalt, auch zusammen.
Woher kommt die Gewalt?
Eine große Rolle spielen Drogenkartelle, die gegeneinander um die Kontrolle über Handelswege und Verteilstrukturen kämpfen. Es geht um Heroin und Kokain, das in die Vereinigten Staaten geschmuggelt wird, oder um synthetische Drogen wie Crystal Meth. Dahinter steckt ein Staat, der oft korrupt ist, und Politiker und Sicherheitsbeamte, die zu Komplizen werden. Mancherorts haben die Menschen auch so gut wie keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt legal zu verdienen. Viele fangen dann an, für die Drogenmafia zu arbeiten.
Ich kann das nachvollziehen: In einem Land, in dem man schnell sterben kann, sagen sich manche halt, ich sterbe sowieso, dann will ich wenigstens bis dahin noch ein gutes Leben. Das ist auch ein Versagen der Politik, die es nicht schafft, den Leuten eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten.
Was bedeutet denn Widerstand für die Menschen, die Sie getroffen haben?
Das können die Mexikanerinnen und Mexikaner nur selbst beantworten. Hier in Europa schien mir die Rede vom Widerstand immer etwas Altmodisches zu sein, das aus der Zeit des Kalten Krieges und der damaligen ideologischen Grabenkämpfe übrig geblieben ist. In Lateinamerika dagegen geht es einfach darum, dass die Leute sich selbst behaupten. Das ist zumindest mein Eindruck. Widerstand bedeutet oft, sich angesichts der herrschenden Strukturen, der wirtschaftlich schwierigen Bedingungen und der Gewalt nicht unterkriegen zu lassen. Den Kopf oben zu behalten. Immer wieder zu versuchen – je nachdem wieviel Kraft man hat – für sich sel- ber und seine Leute Freiräume zu erobern. Das kann durch politischen Aktivismus passieren oder durch Kunst und Musik, zum Beispiel, wenn eine Maya-Sängerin in ihrer Sprache singt. Fröhlich zu sein, selbst wenn die Zeiten nicht so sind – auch das kann Widerstand sein.
Im Süden, in Yucatán, haben Sie diese Sängerin getroffen. Gibt es viele junge Menschen, die ihre indigenen Traditionen pflegen im Sinne des Widerstands?
Ob das so flächendeckend ist, weiß ich nicht. Ich habe in Mexiko immer wieder Leute getroffen, für die das wichtiger zu sein scheint als früher, nicht nur junge Leute. Mein Eindruck ist, dass ihre Stimmen lauter werden, und dass sie mehr Anerkennung erfahren. Zugleich ist natürlich die Anziehungskraft der Mainstream-Konsumgesellschaft sehr groß. Manche wollen einfach materiell ein besseres Leben haben und passen sich dafür auch an, andere verzichten bewusst auf Geld, um für ihre indigene Identität zu kämpfen. Das ist das Spannungsfeld, in dem die Leute sich behaupten.
Auf Ihrer Reise waren Sie auch in Chiapas. Welche Wirkung haben die Zapatisten in ihren indigenen Kämpfen heute noch?
Für mich war es schwierig, Zugang zu bekommen, vermutlich hätte ich dafür noch länger in Chiapas bleiben müssen. Freunde sagten mir, dass die Zapatisten mittlerweile den Kontakt nach außen vermeiden, einfach weil sie sagen, ihrem Kampf habe die frühere Offenheit nichts genutzt. Nach allem, was ich mitbekommen habe, konzentrieren sie sich derzeit darauf, ihre Gemeinschaften von unten zu demokratisieren und zu gestalten, in einer Art Graswurzelprozess, der sich nach und nach ausdehnen soll. Einer meiner Gesprächspartner verglich das mit vielen kleinen Inseln, aus denen dann irgendwann ein ganzer Archipel entsteht, weltweit. Das schien mir ein ganz passendes Bild.
Als ich unterwegs war, gab es auch eine indigene Präsidentschaftskandidatin, Marichuy, die von den Zapatisten unterstützt wurde. Ihr Wahlkampf hatte auch über die indigene Gemeinschaft hinaus eine Signalwirkung. Ihre Kandidatur wurde als Hoffnungszeichen wahrgenommen, auch von Leuten, die mit den Zapatisten nichts zu tun haben.
Kann so eine Basisarbeit denn Veränderungen bewirken?
Ich glaube schon, aber es geht halt sehr kleinteilig und langsam voran. In einer Berufsschule sagte mir der Leiter sinngemäß: „Wir haben schon 500 Jahre gewartet. Wir haben Zeit.“ Wer in solchen Zeiträumen denkt, hat es natürlich nicht eilig. Ich denke aber auch: Jede Gemeinde, in der sich der Alltag verbessert, weil die Leute in die Lage versetzt werden, ihr Leben stärker selbst in die Hand zu nehmen, oder jede einzelne Person, die dazu befähigt wird, ist die Arbeit wert.
Sie schreiben auch viel über die Widersprüche, die Sie in Mexiko sehen. Beispielsweise pflegen manche Leute nach außen hin katholische Riten, folgen aber in Wahrheit ihren alten indigenen Traditionen...
Das habe ich häufig gesehen. Zum Beispiel bei der Jungfrau von Guadalupe, die nördlich von Mexiko-Stadt angebetet wird, an einem Ort, an dem zuvor eine weibliche indigene Gottheit verehrt wurde. Offenbar greifen bestimmte Symbole der Jungfrau von Guadalupe – etwa die Sterne auf ihrem Mantel – Symbole auf, die vor dem Katholizismus da waren. Die katholische Kirche hat sich das in Mexiko auch zunutze gemacht. In dem Maß, in dem die Erzählung der Erscheinung der Jungfrau von Guadalupe sich ausbreitete, konvertierten sehr viele Menschen zum Katholizismus. Hätte die Jungfrau nicht so wunderbar zur älteren Überlieferung gepasst, wären es vermutlich weniger gewesen. Die Pfarrer wussten das. Und für viele Menschen war es wahrscheinlich eine Möglichkeit, ihre ursprüngliche Identität zu bewahren, aber eben unter dem Schleier der katholischen Religion.
Ihre Reise haben Sie im Süden angefangen und sind dann immer weiter in den Norden des Landes gereist. Haben Sie den Norden als sehr anders empfunden? Vielleicht als weniger gewaltvoll?
Gewalt gibt es im Norden mindestens genauso viel. Das hat sehr stark mit der Grenze zu den USA zu tun, denn an der ballt sich ganz viel: Dort sind die Drogenkartelle, deren Hauptinteresse es ja ist, die illegale Ware über die Grenze zu bringen. Dort sind die Migranten, die es nicht über die Grenze schaffen. Und dort werden die Gewehre, die in den USA relativ frei verkäuflich sind, nach Mexiko geschmuggelt, und die Kartelle benutzen sie dann für ihren Krieg.
Trotzdem habe ich den Norden als sehr anders empfunden. Es gibt eine kulturgeographische Grenze ungefähr auf der Höhe von Mexiko-Stadt. Dort und weiter südlich gab es die alten indigenen Hochkulturen, die Maya, die Azteken, mit zum Teil sehr ähnlichen Symbolen und Mythen. Weiter im Norden gibt es zwar auch indigene Gemeinschaften, aber mit einer anderen Geschichte. Mein Eindruck ist, dass man diese alte Trennung immer noch ein bisschen merkt. Je weiter man in den Norden kommt, desto spürbarer wird auch die Nähe zu den USA.
Hatten Sie den Eindruck, dass es im Norden weniger Akte des Widerstands zu finden gibt?
Nein, warum? Gründe zum Widerstand gibt es dort mindestens genauso viele. In Los Mochis habe ich Mütter getroffen, die ihre verschwundenen Kinder suchen, gegen viele Hindernisse. In Tijuana habe ich einen Musiker und eine Graffiti-Künstlerin getroffen, die daran arbeiten, sich ihre kulturellen Freiräume zu bewahren.
Und die auch nicht unbedingt indigen sein müssen...
Es wäre verkehrt, zu behaupten, Widerstand müsse indigen sein. Unter den Müttern in Los Mochis habe ich das nie als Thema empfunden. Über Identitätsfragen – ob indigen oder nicht – wurde da gar nicht gesprochen. Und ich glaube, einen größeren Akt des Widerstands als den ihren kann man sich fast nicht denken.
Was meinen Sie damit?
Was sie tun, kann lebensgefährlich sein. Ich mag mir das gar nicht vorstellen: Mein erwachsener Sohn – meistens sind es die Söhne – kommt plötzlich nicht mehr nach Hause. Vielleicht bekomme ich zugetragen, dass er von Bewaffneten entführt worden ist, vielleicht erfahre ich gar nichts. Dann gehe ich zur Polizei und die sagt, wir nehmen das auf, aber mehr tun wir nicht, und ich weiß genau, die Polizisten könnten mit den Entführern unter einer Decke stecken. In so einer Situation dann zu sagen, das ist mir jetzt egal, dann fange ich halt selber an zu suchen, finde ich unglaublich mutig. Ich weiß nicht, ob man widerständiger sein kann als diese Frauen.
Eine Frau sagte Ihnen in einem Gespräch, dass es für Frauen in Mexiko normal ist, Angst zu haben. So eine Aussage ist erschreckend. Wie ordnen Sie diese ein? Mexiko ist ein machistisches Land. Selbstverständlich gibt es auch mexikanische Männer, die keine Machos sind. Aber offenbar ist es für viele normal, dass Männer zum Beispiel im öffentlichen Raum Frauen auch körperlich angehen, wenn sie Lust darauf haben. Es gilt als männlich, viele Frauen zu haben, auch sexuell. Und die Polizei beschützt die Frauen oft nicht, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz oft nach Fällen von sexueller Gewalt auch Aussagen wie „sie hat ja einen kurzen Rock angehabt“, „sie hat es ja provoziert“ oder „sie hat es doch gewollt“. Und im Krieg der Drogenmafia um Einflussgebiete und um die Kontrolle von Territorien werden Frauen oft gezielt angegriffen. Sprich, wenn du deinen Gegnern schaden willst, dann misshandelst oder vergewaltigst du seine Frauen oder bringst sie um.
Der Titel von Ihrem Buch, „Niemand liebt das Leben mehr als wir. Mexiko – Unterwegs in einem Land voller Hoffnung“, klingt dennoch sehr zuversichtlich. Woher nehmen die Menschen in Mexiko diese Zuversicht an- gesichts der schwierigen Umstände?
Ich glaube, viele dieser Menschen in den Ländern Lateiname- rikas, nicht nur in Mexiko, haben gelernt, auch die kleinen Dinge zu schätzen und daraus Kraft zu ziehen. Wenn man zum Beispiel an einem Abend mit der Familie oder mit den Freunden zusammen ist und alle haben genug gegessen und sind zufrieden in dem Moment. Und dann sitzt man noch zusammen, erzählt sich etwas oder hört Musik. Weil sie viel- leicht auch wissen, dass es morgen ganz anders sein kann. Und es nichts bringt, sich selbst diese kleinen Momente mit Sorgen zu füllen. Wahrscheinlich sind die Sorgen nie weg. Aber trotzdem ist man froh, dass sie für den Moment in den Hintergrund treten. Ich glaube, viele schaffen gezielt Räume, wo sie sich treffen und austauschen können. Gemeinschaft ist ein wichtiger Punkt.
Sie meinen, es werden Kollektive gebildet, um gemeinsam etwas zu erreichen?
Es muss gar nicht unbedingt ein gezieltes Zusammenkommen sein, um etwas zu erreichen. Es kann auch einfach nur sein, dass man zusammensitzt und den Moment miteinander genießt. Als ich die ersten Male in Lateinamerika unterwegs war, gab es immer wieder Leute, die sagten „ach, wie schön, dass wir diesen Moment miteinander geteilt haben“. Das Wort dafür ist ja compartir. Compartir un momento. Compartir algo. Ich habe nie verstanden, was das soll. Ja, wir haben halt einen Tee zusammen getrunken. Was ist jetzt das Besondere daran? (lacht) Irgendwann ist mir aber klargeworden, dass diese Momente für die Leute wirklich ganz zentral sind. Dass da viel Kraft entsteht.
Hoffen die Menschen in Mexiko darauf, dass der neue Präsident, Andrés Manuel López Obrador, das Land jetzt zum Besseren verändert?
In San Cristóbal war ich auf einer Wahlparty, und die Gäste dort hatten ganz sicher sehr viel Hoffnung auf Veränderung. Was ich jetzt aber aus der Entfernung mitkriege, ist eher enttäuschend. Zwei Beispiele: López Obrador geht kritische Journalisten an, vielleicht nur verbal, aber in einem Land wie Mexiko, in dem auch viele Journalisten gefährlich leben oder umgebracht worden sind, ist das gefährlich. Er unterscheidet zwischen Freunden und Feinden, auch bei Journalisten. Das gefährdet natürlich die Pressefreiheit.
Und in der Migrationspolitik hat er im Wahlkampf verspro- chen, die Migrantinnen und Migranten aus Zentralamerika, die durch Mexiko in Richtung USA ziehen, menschenwürdiger zu behandeln. Aber gerade macht er unter Druck der US- Regierung von Donald Trump das Gegenteil. Er verstärkt im Süden die Grenzkontrollen, er militarisiert die Grenzen, und er trägt es im Norden mit, dass Menschen, die in den USA ihre Asylanträge gestellt haben, in Mexiko unter lebensgefährlichen Bedingungen auf ihre Anhörung warten müssen. Statt die Menschenrechte der Migranten zu schützen, bringt er sie so in noch größere Gefahr als zuvor.
Alexandra Endres ist Buchautorin, Journalistin und Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Viele ihrer Recherchereisen haben sie auch nach Lateinamerika geführt. Im Juli 2017 ist ihr Buch „Wer singt, erzählt – wer tanzt, überlebt. Eine Reise durch Kolumbien“ im DuMont Reiseverlag erschienen. Im Oktober 2019 erschien im selben Verlag ihr neues Buch „Niemand liebt das Leben mehr als wir. Mexiko – Unterwegs in einem Land voller Hoffnung“.