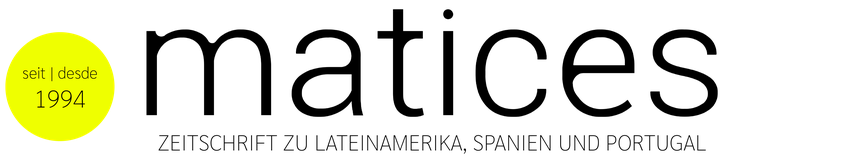Die Angst bleibt
Spaniens Wirtschaft wächst, die Gesellschaft bleibt arm
Die Euro-Krise: Griechenland, Spanien, Portugal und Irland haben Dutzende Milliarden an Hilfe bekommen und sollten dafür ihre Wirtschaft auf Vordermann bringen. Nun verkündet Spanien das Ende der Krise. Das Land steht an der Spitze des Aufschwungs - die Wirtschaft wächst und die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken. Ja, viele Menschen finden wieder Arbeit, aber nur unter prekären Bedingungen. Die Verarmung ist bereits bis zur Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Doch die Empörung der Menschen bleibt stumm.
von Conrad Lluis Martell
Spanien ist Wachstumstreiber in der Wirtschaftszone“ (Spiegel Online), „Arbeitsmarkt erholt sich. Arbeitslosenzahl in Spanien auf tiefstem Stand seit August 2009“ (Fokus) oder „Spain’s reforms point the way for southern Europe“ (The Economist) – derartige Schlagzeilen scheinen zu bestätigen, was Spaniens Präsident Mariano Rajoy in letzter Zeit immer wieder betont, so etwa Anfang des Jahres: „Spanien wächst heute wieder stark, ausgeglichen und nachhaltig, und das auf soliden Fundamenten. Es schafft auf intensive Art und Weise Arbeit, hat seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen, die Aussichten sind vielversprechend.“ Rajoys Worte wollten im Forum „Spain Investor’s Day“ Eindruck machen, internationale Anleger und Konzerne anziehen. Und tatsächlich scheinen die Wirtschaftsdaten den Kurs von Rajoys konservativer Regierung zu bekräftigen: Spanien wuchs im Jahr 2017 um 3,5 Prozent und stand damit an der Spitze der OECD-Staaten. Parallel fiel die Arbeitslosenrate um mehr als zwei Prozent, von 18,6 (2016) auf 16,5 Prozent Ende 2017. Zudem stieg die Touristenzahl erstmals über die 80-Millionen-Marke, womit Spanien – nur hinter Frankreich – zum beliebtesten globalen Reiseziel avanciert.
Die dunklen Krisenzeiten, als Spanien 2013 mit knapp 27 Prozent Arbeitslosigkeit und konstant sinkender Wirtschaftsleistung kurz davor stand, genauso wie Griechenland unter einen Rettungsschirm mitsamt drakonischer Maßnahmen zu geraten, scheinen endgültig vorbei. Die viertgrößte Wirtschaft der Eurozone wächst wieder – und besetzt nun gar mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Luis de Guindos die Vizepräsidentschaft der Europäischen Zentralbank (EZB). Ist also die Krise endgültig vorbei? Oder verbirgt sich hinter den positiven Wirtschaftszahlen eine andere, unerfreulichere Realität?
Die Krise hinterlässt Armut und Ungleichheit
Spanien hat sich heute damit abgefunden, dass die Arbeitslosenrate von 16 Prozent bei den Unter-30-Jährigen mehr als doppelt so hoch ist, dass knapp eine Million Haushalte weder Einkommen noch Unterstützung erhalten (in Spanien bleibt nach dem Arbeitslosengeld nur die Rente der Eltern oder Großeltern), dass Zwangsräumungen weiter ein Massenphänomen darstellen (2016: 63.000 Räumungen), dass trotz ökonomischem Aufschwung Armut und Ungleichheit zunehmen. Neben Bulgarien, Litauen und Griechenland zählt Spanien zu den EU-Ländern mit der stärksten Ungleichheit. Hinter den Zahlen verbirgt sich ein harter Alltag. Tagein tagaus scheppern die Einkaufswägelchen auf den Straßen, meist sind es Menschen aus Südosteuropa oder Afrikaner, die im Müll nach recyclebaren Materialien oder schlichtweg nach Essen suchen. Der pakistanische Gemüsehändler um die Ecke hat 14 Stunden lang offen, sieben Tage in der Woche. Viele Kneipen werden mittlerweile von Chinesen betrieben. Bei ihnen packt die ganze Familie mit an, nur so kann sich der Betrieb trotz niedrigem Umsatz über Wasser halten.
Doch nicht nur die Unterschichten und „Eingewanderten“ bekommen die Krise zu spüren. Die Verarmung zieht bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein. Die Mittelschicht ist geschrumpft, verarmt und hat an Anziehungskraft eingebüßt. Spanien verstand sich lange als Mittelklassengesellschaft. Selbst wer in der Gesellschaft weiter unten – und teils auch weiter oben – war, verortete sich in der Mittelschicht. Dreierlei zeichnete die clases medias maßgeblich aus: gesicherte Arbeitsverhältnisse, ein individualistischer, konsumorientierter Lebensstil, und vor allem auch Wohneigentum. Um zur Mittelklasse zu zählen, bedurfte es neben dem Besitz des Hauptwohnsitzes zumindest noch einer Zweitresidenz für das Wochenende oder die Ferien. „Queremos un país de propietarios, no de proletarios“ („Wir wollen ein Land von Eigentümern, nicht von Proletariern“) – dies war eine der Wirtschaftsmaximen der Franco-Diktatur, um aufmüpfiges Arbeiterbewusstsein stillzulegen und durch kleinbürgerlichen Konformismus zu ersetzen. Eigentum ist Sicherheit, so hat es sich im Gesell- schaftsbewusstsein bis heute gefestigt. Tatsächlich speiste sich Spaniens Immobilienblase wesentlich aus der millionenfachen Entscheidung von Einzelhaushalten, trotz oft bescheidenen Mitteln eine Hypothek aufzunehmen – wohlweislich flankiert von einem Bankensektor und einer Gesetzgebung, die diesem Verhalten nicht entgegenwirkten, sondern es zusätzlich anheizten.
Der Traum von der Mittelschicht – und sein Zusammenbruch
Die Vorstellung, Spanien sei zur Mittelklassengesellschaft geworden, war ein Traum auf Pump. Und die Europäische Union finanzierte geradezu diese Blase: ob mit Strukturfonds für aufwändige Infrastrukturprojekte (etwa Schnellzugtrassen, Zuschüsse für die Agrarwirtschaft oder Flughäfen) oder mit Kapitalanlagen in Milliardenhöhe. So schnell wie möglich sollte Spanien, die viertgrößte Wirtschaft der Euro-Zone, zum absatzstarken Abnehmer der nordeuropäischen, vornehmlich der deutschen, Exportwirtschaft aufsteigen. Nicht nur das Übergewicht solch unsteter Branchen wie des Tourismus und der Immobilien, auch ein immer stärkeres Handelsdefizit (zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts zwischen 2006 und 2008) hätte die Politik in Alarmbereitschaft versetzen müssen. Doch weder die Konservativen (1996 bis 2003 an der Regierung), noch die Sozialisten (2003 bis 2011 an der Spitze), setzten der „Politik der Blase“ etwas entgegen. Als die Krise mit voller Wucht einschlug und den sozialen Zusammenhalt des Landes in Frage stellte, wurde nicht etwa der Sozialstaat gestärkt oder ein expansives Investitionsprogramm lanciert, um die Krise wenigstens partiell abzufangen. Vielmehr einigten sich die beiden Volksparteien auf einen harten Austeritätskurs, der die Brüsseler Anordnungen beflissen umsetzte. So implementierten Sozialisten und Konservative im August 2011 die Schuldenbremse in der Verfassung – was für gesellschaftlichen Unmut sorgte.
Als die Blase platzte und die Krise kam, politisierten sich gerade viele junge Leute unter Mottos wie „Sie repräsentieren uns nicht“, „Wir sind keine Ware in den Händen von Politikern oder Bankern“ oder „Zu wenig Brot für zu viele Diebe“. Im Frühling 2011 campierten Tausende wochenlang auf den spanischen Hauptplätzen – von der Puerta del Sol in Madrid bis zum Plaça Catalunya in Barcelona. Die Protestler wurden als indignados, die Empörten, bekannt. Dass sie auf große gesellschaftliche Zustimmung stießen, hing sowohl mit den Forderungen als auch mit dem Profil der Proteste zusammen. Zwar wurden die Politik- und Wirtschaftseliten hart kritisiert. Doch die Forderungen der indignados waren weniger utopisch als vielmehr realpolitisch ausgerichtet: Einerseits wurde mehr Demokratie, genauer, eine partizipativere und repräsentativere Demokratie verlangt, andererseits ein starker Sozialstaat und ein Ende der Austeritätspolitik gefordert. Zudem repräsentierte der Protest einen breiten Querschnitt der Bevölkerung. Auf den Straßen und Plätzen standen die Söhne und Töchter der Mittelschicht, die heute 50 bis 70-jährige Generation der Baby Boomer, die das überkommene Modell zentral mitverantwortet hatte und lange davon profitierte (und profitiert). Der Erwartungshorizont der jungen Generation, ihr Lebensstandard könne so hoch wie jener ihrer Eltern werden, brach jäh in sich zusammen.
Die Empörung breitete sich aus...
Der Protest der nachrückenden Mittelschichtsgeneration schien vielen Spaniern nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu geboten. Die Empörten warfen eine Frage auf, die bis heute brisant bleibt: Was kommt nun, da der Mittelschichttraum in weite Ferne rückt? So versuchen nicht nur die Empörten, sondern auch Kollektive wie „Jugend ohne Zukunft“ seit Jahren, die Verarmung der jungen Generation in Politisierung zu überführen. Mottos wie „Ohne Haus, ohne Job, ohne Rente, ohne Angst!“ fruchteten bei vielen – und fanden in den jungen Parteien Podemos und Ciudadanos politische Ausdruckschancen nach links und rechts. Podemos und Ciudadanos umgibt die Aura des Neuen, sie gelten als Vertreter einer „neuen Politik“, die auf je eigene Weise einen Ausweg aus der Krise bieten. Podemos (deutsch: Wir können), Anfang 2014 von kritischen Akademikern gegründet, trat als Partei der Empörten auf und warb für einen linken Aufbruch. Er drehte sich einerseits um einen neuen Gründungsprozess, dessen Pfeiler eine grundsätzlich erneuerte Verfassung sein sollte, und andererseits um die alte sozialdemokratische Vision eines starken Sozialstaates, der die Bürger sozial schützt und großflächig investiert. Demgegenüber bot die rechtsliberale Partei Ciudadanos, 2006 von konservativen Intellektuellen gegründet, ein radikal entgegengesetztes Rezept: Spanien lässt sich nur dann zu einem modernen Staat mit westeuropäischen Lebensstandards machen, wenn die Wirtschaft weiter liberalisiert, der Staat verschlankt und entbürokratisiert und in der Gesellschaft der Unternehmergeist stärker verankert würde. So lautet das Kernprogramm von Ciudadanos, das vor allem bei den jungen urbanen Mittelschichten fruchtet. Trotz aller Unterschiede sprechen Podemos und Ciudadanos besonders die neuen Generationen an, denen die alten Volksparteien, der sozialistische PSOE und der konservative PP, zu verstaubt, korrupt und bürokratisch sind. Podemos und Ciudadanos, sie haben die Hegemonie von Sozialisten und Konservativen gebrochen – bei den letzten Generalwahlen kam Podemos auf 21 und Ciudadanos auf 13 Prozent – und ein dynamisches Vier-Parteien-System geschaffen. Während in Großstädten wie Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia oder La Coruña linke Bündnisse regieren, die Podemos nahestehen, stellt Ciudadanos derzeit die Vormachtstellung der konservativen Regierungspartei in Frage. Nachdem sie in den katalanischen Regionalwahlen von Dezember 2017 stärkste Kraft wurden, erleben die Rechtsliberalen ein Umfragehoch. Ciudadanos- Chef Albert Rivera mit seinen 38 Jahren träumt davon, ein spanischer Macron zu werden, um mit (neo-) liberalen Reformen Spaniens Modernisierung zu vollenden. Während indes in der Parteienlandschaft ein unerbittlicher Machtkampf vonstattengeht, bleiben die Arbeitsverhältnisse miserabel, die Renten gering und die Arbeitslosigkeit ein Massenphänomen. Die Allermeisten schlagen sich mit Händen und Füßen durch. Die Wenigsten sind in - linken oder rechten - Parteien, Bewegungen oder Gewerkschaften organisiert. Die Mentalität des auf sich gestellten Einzelkämpfers herrscht vor: Hier einige Monate jobben, wieder wechseln, dann wieder ohne Arbeit und eine Zeit lang bei den Eltern leben, vielleicht auswandern, um als Kellner, Sprachlehrerin oder Praktikantin einen Neustart in London oder Berlin zu wagen.
...doch veränderte sie etwas?
Warum wehren sich die Betroffenen nicht stärker, ob am Arbeitsplatz oder auf der Straße? Meist nicht aus Mangel an kritischem Bewusstsein, sondern aus Furcht, die kleinen Sicherheiten zu verlieren, die sich auftun. Anders als 2012 oder 2013, im Hoch der Krise, ist es derzeit wieder möglich, Jobs zu finden. Unsicher, schlecht bezahlt und niedrigqualifiziert. Doch Arbeit ist Arbeit, und das ist besser als nichts, so denken viele.
Der Hotelkaufmann Jaume (34) etwa arbeitet seit acht Jahren in einer Hotelkette. 25 Stunden in der Woche werden mit 400 Euro monatlich entlohnt, Überstunden schwarz bezahlt. Alle sechs Monate kündigt ihm der Betrieb, um ihn einen Monat später wieder anzustellen. Damit spart es sich die Firma, sein Gehalt an sein Dienstalter anpassen zu müssen.
Warum wehrt sich Jaume nicht oder sucht sich einen anderen Arbeitgeber, der mehr bezahlt und einen faireren Vertrag bietet? Die Ungewissheit, seinen Job zu kündigen und dann ohne irgendetwas dazustehen, wolle er lieber nicht eingehen, meint Jaume. Er lebe weiter bei den Eltern, mit seinem Lohn finanziere er sich ein Tourismusstudium in Teilzeit, von dem er hofft, dass es ihn einmal beruflich voranbringe. Von politischem Engagement hält Jaume wenig. Politisch sei er gemäßigt, in Wirtschaftsfragen liberal – gesellschaftlich fühle er sich als Angehöriger der Mittelschicht, obschon er zugibt, seinen Lebensstandard nur dank der guten Rente seines Vaters halten zu können. Jaume ist damit zufrieden, dass er anders als viele seiner Bekannten zumindest einen bezahlten Job hat. Jugend ohne Zukunft, Jugend ohne Angst? Die Jungen haben sich mit ihrer Deklassierung abgefunden. Doch eine große Angst hält sich: Dass der soziale Abstieg einmal nach ganz unten weisen könnte.
Conrad Lluis Martell ist Doktorand am Institut für Soziologie der Universität Hamburg und am Institut Universitario de Cultura der Universitat Pompeu Fabra Barcelona. Er forscht zur Bewegung der Empörten und deren Auswirkungen auf Spaniens Politik und Gesellschaft. Außerdem arbeitet er als freier Journalist, u.a. für die Wochenzeitung „Der Freitag“. (Literaturempfehlungen zum Thema: Huke, Nikolai (2016): Krisenproteste in Spanien., Monge Lasierra, Cristina (2017): 15M. Un movimiento político para democratizar la sociedad., Ro- dríguez, Emmanuel; López, Isidro (2011): The Spanish Model, in: New Left Review 69, May-June 2011).
Die Vorstellung, Spanien sei zur Mittelklassengesellschaft geworden, war ein Traum auf Pump. Und die Europäische Union finanzierte geradezu diese Blase.
Die Empörten warfen eine Frage auf, die bis heute brisant bleibt: Was kommt nun, da der Mittelschichttraum in weite Ferne rückt?
Anders als 2012 oder 2013, im Hoch der Krise, ist es derzeit wieder möglich, Jobs zu finden. Unsicher, schlecht bezahlt
und niedrigqualifiziert.