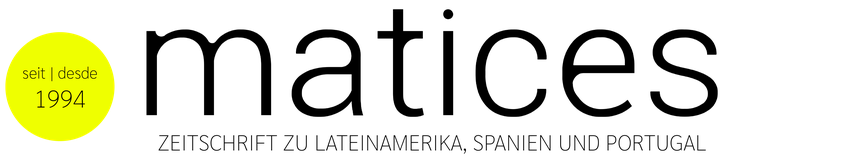Es war einmal ein Land der Bäume
Guatemala bekämpft Korruption und Drogenhandel, aber für die humanitäre Krise im Dürrekorridor fehlt das Geld
In Guatemala und in großen Teilen Mittelamerikas leidet die Bevölkerung seit Jahren unter den Folgen des Klimawandels. Das Klimaphänomen El Niño führt dazu, dass es an der Westküste Mittelamerikas heißer ist und die Trockenperioden länger anhalten. Der Regen bleibt aus und die Pflanzen tragen keine Früchte. 2015 stuften die Vereinten Nationen die Situation im sogenannten Dürrekorridor als besonders gravierend ein, und für 2016 gibt es wenig Anzeichen der Besserung. Nothilfe wird dringend benötigt,aber ein großer Teil des Staatsetats wird für den Kampf gegen den Drogenhandel und die Organisierte Kriminalität ausgegeben. Institutionen wie der Arbeiter-Samariter Bund leisten Hilfe vor Ort.
von Katharina Mauz
Porfirio Ramos, seine Frau Maria Rosa und ihre acht Kinder leben in der Gemeinde Conacaste, hoch oben in der Bergregion des Departamentos Chiquimula im Osten des Landes. Die Hänge sind steil, die Böden ausgewaschen und verheißen eine karge Ernte – wenn überhaupt. Wie alle Familien in der Gemeinde leben Porfirio und Maria Rosa von dem, was sie anbauen und ernten können. Doch in den letzten Jahren fielen die Ernten viel geringer als üblich aus, im Juni und Juli regnete es kaum. Dabei wird der Regen gerade in diesen Monaten dringend gebraucht, damit Bohnen, Mais- und andere Gemüsepflanzen Früchte bilden können. Die meterhohen Maispflanzen haben in diesem Juni keine Kolben. In der Vergangenheit standen Porfirio und Maria Rosa immer wieder vor der Entscheidung, ob sie die wenigen Maiskörner ihrer Ernte essen oder für die Aussaat im September aufbewahren und so auf die zweite Ernte des Jahres hoffen sollen.
Es war einmal ein Land der Bäume
"Guatemala" bedeutet auf Quauhtemallan, einer der vielen indigenen Sprachen des Landes, so viel wie „Land der Bäume“. Heutzutage stehen aber längst nicht mehr so viele Bäume auf den einst grünen Bergen. In 40 Jahren Bürgerkrieg wurde die größtenteils indigene Bevölkerung aus den fruchtbaren Tälern vertrieben und hat sich in die Höhen der guatemaltekischen Berge zurückgezogen. Sie konnten keine Agrarreform durchsetzen und wurden als Linke und Oppositionelle verfolgt. Noch heute liegt der Großteil des Landes in Händen weniger Großgrundbesitzer. Viele der indigenen Bevölkerung leben in den Bergen und um Land zu gewinnen und Grundnahrungsmittel wie Mais und Bohnen anbauen zu können, roden sie die Hänge. Das Brennholz aus den Rodungen verkaufen sie in der Stadt oder verwenden es zum Feuermachen. In fast allen Familien auf dem Land wird über offenem Feuer gekocht. Gas wird hier – anders als beispielsweise in Ecuador – vom Staat nicht subventioniert. Wenn dann allerdings der starke Regen einsetzt, den das Wetterphänomen La Niña mit sich bringt, sind Überflutungen und Bergrutsche die Folge.
Ein Land, in dem die Besitzverhältnisse sehr ungleich verteilt sind
Laut UN ist Guatemala ein mittleres Einkommensland mit einem Wirtschaftswachstum von vier Prozent. Aber der Wohlstand ist extrem ungleich verteilt. Während einige wenige Familien in Guatemala-Stadt vom Wirtschaftswachstum profitieren können, sterben 30 von 1.000 Kindern noch vor Vollendung ihres ersten Lebensjahres an den Folgen von Unterernährung. Das ist der höchste Anteil chronisch unterernährter Kinder in Lateinamerika. Knapp die Hälfte der Guatemalteken leidet an Hunger, 25 Prozent leben in extremer Armut. Die Hungersnot in Guatemala ist eine humanitäre Krise. Von den 3,5 Millionen Einwohnern im Dürrekorridor brauchen 2 Millionen sofortige Nahrungsmittelhilfe.
Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) leistet diese Hilfe in Guatemala sowie in Honduras, Nicaragua und El Salvador mit Mitteln des deutschen Entwicklungsministeriums (BMZ) und des Auswärtigen Amtes.
Im Departamento Chiquimula werden knapp 1.000 Familien in vier Gemeinden unterstützt. Der Bedarf wäre eigentlich mindestens doppelt so groß, aber die Mittel des ASB reichen dafür nicht aus,
erklärt der ASB Regionaldirektor für Lateinamerika, Alejandro Zurita. Die bedürftigsten Familien erhalten Mais, Bohnen, Zucker und Öl. Das sind Tropfen auf den heißen Stein. Außerdem bekommen sie
Saatgut, das besser an den Klimawandel angepasst ist, und Wasserfilter. Damit wird ihnen ein Stück Selbstständigkeit zurückgegeben und die Hoffnung, bald wieder auf eigenen Beinen stehen zu
können. Der ASB versucht auch, die strukturellen Probleme im Land zu verändern. Würde man Terrassen anlegen, könnte das die Erosion verlangsamen und allzu schnelles Ausschwemmen der Böden
verhindern. Zuerst war die Skepsis groß. Doch die Versuchsfelder, die an strategisch geschickten Stellen angelegt wurden und die höheren Erträge durch veränderte Anbaumethoden und den Einsatz von
biologischem Saatgut, statt dem weit verbreiteten Monsanto-Saatgut, überzeugten schlussendlich.
Ein Land, in dem Korruption herrscht
Für die Mitglieder der Parlamentskommission für Ernährungssicherheit in Guatemala-Stadt scheint die Situation im Dürrekorridor nicht wichtiger als Entscheidungen über den öffentlichen Nahverkehr. Jimmy Morales wurde Anfang des Jahres – ohne eigenes Regierungsprogramm – zum neuen Präsidenten des Landes gewählt und löste so die von Korruptionsfällen geschüttelte Regierung Otto Peréz' ab. Deshalb sind die Mitglieder der Kommission für Ernährungssicherheit alle neu in der Politik. Sie sind sich einig: Die Armutsbekämpfung hat zwar Priorität in der Politik von Morales, allerdings müsse man erstmal der Korruption Herr werden. Die in Guatemala weit verbreitete Korruption ist in der Tat ein Grund, warum nur ein geringer Teil der Staatshilfen in Gemeinden wie Conacaste ankommt. Ein weiterer und vielleicht viel tiefgreifender Grund ist, dass in Guatemala ein großer Teil des Staatsetats für den Kampf gegen den Drogenhandel und die Organisierte Kriminalität ausgegeben wird. Diesen Kampf zu führen ist allerdings keine souveräne Entscheidung der guatemaltekischen Politik, sondern von den USA forciert. Um ihren „Hinterhof“ sauber zu halten, knüpfen sie die Entwicklungszusammenarbeit in Mexiko und Zentralamerika daran, dass diese Länder den Drogenhandel und die Organisierte Kriminalität bekämpfen – mit Geld, das dann im Gesundheits- und Bildungswesen, in der Infrastruktur und in der Nothilfe fehlt. Porfirio in den steilen Bergen Chiquimulas weiß von diesen Zusammenhängen vermutlich kaum etwas. Aber er weiß, dass er mit seinen beiden älteren Söhnen über die nahe Grenze nach Honduras gehen wird, um dort auf einer Kaffeeplantage zu arbeiten, wenn auch für die zweite Ernte dieses Jahres der Regen ausbleibt. Doch auch auf den Kaffeeplantagen Honduras hat der Klimawandel gravierende Veränderungen bewirkt. Aufgrund der steigenden Temperaturen sind immer mehr Pflanzen von Kaffeerost La Roja befallen. Die Erträge fallen geringer aus und das schlägt sich in den Tageslöhnen der Arbeiter nieder. In den vergangenen Jahren verdienten Porfirio und seine Söhne umgerechnet bis zu 18 Euro am Tag, jetzt sind es nur noch sechs Euro. Der Trockenkorridor in Guatemala breitete sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich aus. Waren 2014 acht Departamentos betroffen, so sind es 2016 bereits 22. Erdbeben, Überflutungen, Wirbelstürme und Dürren – laut Weltrisikoindex belegt Guatemala nach drei Inselstaaten den traurigen vierten Platz auf der Liste der am stärksten vom Klimawandel betroffenen und von Naturkatastrophen gefährdeten Länder. Auch Nicaragua, El Salvador und Honduras schneiden kaum besser ab. Mittelamerika gehört zu den verwundbarsten Regionen der Welt.
Ein Land, in dem Kinder an Hunger sterben
In Guatemala leiden 49 Prozent der unter Fünfjährigen an chronischer Mangelernährung. In Departamentos wie Chiquimula, die besonders stark von der Dürre betroffen sind, sind es mehr als 80 Prozent. Im therapeutischen Ernährungszentrum in Jocotán, der Provinzhauptstadt Chiquimulas, drängen sich Mütter mit ihren akut oder chronisch unterernährten Kindern in zwei stickigen Räumen. Eigentlich sind die Kinder in Behandlung, einige der Mütter sehen jedoch so aus, als würden sie die Hilfe genauso dringend benötigen. Manche Kinder sind abgemagert und viel zu klein für ihr Alter, andere haben aufgedunsene Gesichter, die Farbe ist aus ihren dunklen Haaren gewichen, sie schauen apathisch ins Leere und weinen nicht einmal. Vor allem im Juni und Juli, wenn die Folgen der ausgebliebenen Ernte besonders stark zu spüren sind, kommen viele Mütter mit ihren Kindern in das Ernährungszentrum nach Jocotán. Dort werden die Kinder medizinisch versorgt und mit einer besonders protein- und kalorienreichen Nahrung versorgt. Eigentlich sollte diese Therapie 20 Tage dauern, oftmals verlassen die Mütter aber bereits vorher die Einrichtung. Der familiäre Druck ist zu groß: so lange können sie nicht von zu Hause fernbleiben, wo der Mann allein mit den anderen Kindern ist und die älteren Geschwister sich um die jüngeren kümmern.
Ein Land, in dem man auf Regen hofft
Fragt man Maria Rosa nach ihrem Wunsch für die Zukunft, antwortet sie, dass sie sich wünscht, morgens früh um vier Uhr wieder aufzustehen, die Tortillas für das Frühstück zuzubereiten, ihren Mann aufs Feld und die Kinder in die Schule zu schicken – wenn denn die Lehrerin vorbeikommt. Sie wünscht sich, die Hütte sauber zu halten und mittags wieder Tortillas, und wenn sie Glück haben, Bohnen kochen zu können, sich um die Heilkräuter im Garten und die paar Hühner zu kümmern und mit Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Die Menschen hier in den Bergen führen ein einfaches Leben und hoffen auf ein Morgen und ein Übermorgen. Sie hoffen nicht auf Strom, fließendes Wasser oder eine Abwasserregelung. Diese Träume scheinen für sie in noch zu weiter Ferne. Obwohl es im Juli und August etwas mehr als in den vorherigen Jahren geregnet hat, wird die erste Ernte dieses Jahres nicht sehr reich ausfallen. Ob die Ernte im Herbst gut wird, ist ungewiss. Ob Porfirio und Maria Rosa mit ihren Kindern die Gemeinde in den Bergen verlassen wollen? Nein. Wo sollten sie auch hin? Das Stück Land in den Bergen ist das letzte Stückchen Land, das ihnen geblieben ist. Und wenn sie in die Stadt gingen, dann würden sie dort in den Armenvierteln am Stadtrand hausen müssen. Nein, sie bleiben lieber in den Bergen und hoffen auf den Regen.
Katharina Mauz ist Redakteurin bei matices. Die Reportage ist auf der Grundlage einer Pressereise mit dem Arbeiter-Samariter-Bund entstanden. Dieser arbeitet mit lokalen Partnern vor Ort und nimmt Spenden für die Nothilfe entgegen.