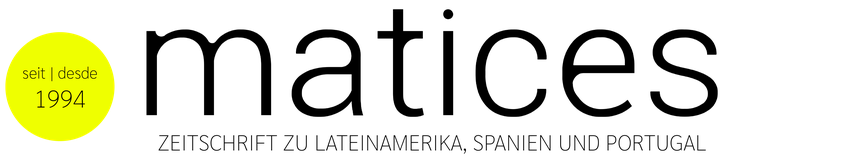La Vega
Reportage aus einem Armenviertel in Caracas
von Dario Azzellini
Erziehung, Gesundheit und Ernährung. In Las Casitas, einem Armenviertel oberhalb der Stadt Caracas, scheint die Symbiose zwischen den Grundpfeilern der Regierungspolitik Hugo Chávez und den dort seit Jahrzehnten aktiven Stadtteilinitiativen gelungen.
Unter der heißen Mittagssonne arbeiten acht junge Frauen auf einem winzigen Feld von höchstens 15 Quadratmetern. Sie lokkern mit Spaten die Erde auf, ziehen Furchen und säen vorsichtig Saatgut aus kleinen Gläsern. Ambar Centeño, Agraringenieurin des „Nationalen Instituts für erzieherische Kooperation“ (INCE), erteilt Ratschläge, erklärt in welchem Abstand und wie tief die Aussaat der Samen erfolgen soll. Wenn alles klappt, sollen hier in wenigen Wochen Tomaten, Zwiebeln, Salat, Paprika und Gurken wachsen.
Wir befinden uns weit oberhalb der Stadt in Las Casitas/Quinta Terraza. Die Armensiedlung, in der 30 Familien leben, ist Teil des Bezirks La Vega des Municipio Libertador, einer der fünf administrativen Distrikte in die Caracas aufgeteilt ist. Venezuelas Hauptstadt liegt in einem Tal und ist umgeben von hohen Bergen. An den Hängen ziehen sich die Armensiedlungen hoch, je höher man kommt, desto ärmer sind die Viertel und ihre Bewohner.
Die Straße hoch nach Las Casitas ist erst vor einigen Jahren geteert worden, an den Rändern stapelt sich der Müll, Container quillen über und einige steile Hänge wurden zu Müllkippen umfunktioniert. Die Müllabfuhr wurde vor vielen Jahren privatisiert, seitdem wird der Müll in den armen Stadtteilen nur noch selten abgeholt. Wasser gibt es hier, wie in allen armen, höher gelegen Stadtteilen, nur alle vier Tage. Das Wasser wird aus Caracas hoch gepumpt und in einer großen Zisterne gelagert. Von dort aus fließt es in die Wasserleitungen der Haushalte, die es wiederum in großen Plastiktonnen abfüllen um in den Tagen ohne Wasser versorgt zu sein. Das Wasser stammt aus einem Stausee in über 600 km Entfernung und gelangt über ein Aquädukt mit 300 Pumpstationen in die Hauptstadt. Durch die anhaltende Dürre der vergangenen drei Jahre herrscht allerdings große Wasserknappheit, so dass auch in Caracas Innenstadt meist nur noch ein schmales Rinnsal aus dem Wasserhahn kommt.
Alle Hände zur Aussaat
Der kleine Acker, auf dem die Frauen schuften, ist ein „Übungsfeld“, ein Pilotprojekt des Programms für urbanen Gemüseanbau „Alle Hände zur Aussaat“, das Anfang 2003 in Zusammenarbeit mit der Welternährungsorganisation FAO gestartet wurde. Einerseits soll damit die Lebensmittelversorgung der armen Bevölkerung verbessert, andererseits die Produktion insgesamt gesteigert werden, denn Venezuela importiert heute 60 Prozent der Lebensmittel. Durch die Konzentration auf die Erdölindustrie wurde das einstige Agrarland Mitte der 70er Jahre zum Lebensmittelimporteur. Oligarchie und Staat vernachlässigten den Lebensmittelanbau, weil die Erdölindustrie größere Gewinne versprach.
Auch in Caracas selbst sind zahlreiche mit Gemüse bebaute Freiflächen zu sehen. Direkt hinter dem Hilton Hotel mitten im modernen Zentrum der Stadt befinden sich zwei mittelgroße Felder, auf denen bereits seit April von einer Kooperative Gemüse angebaut und in einem kleinen Laden verkauft wird. Das INCE stellt für Interessierte und selbst organisierte Gruppen Werkzeug, Saatgut, Beratung und Ausbildung durch Fachkräfte. Wenn Interesse besteht und genügend Land vorhanden ist, erfolgt auch eine Beratung zur Kooperativenbildung und zum lokalen Vertrieb der Produkte.
In Las Casitas wird das nicht der Fall sein, das Land reicht bestenfalls zur Diversifizierung der eigenen Versorgung. Denn der angrenzende Naturpark soll nicht angerührt werden, darin sind sich auch die Bewohner einig. Der Anbau hat hier vor 15 Tagen begonnen. Etwa 20 Personen, bis auf einen Jugendlichen alles Frauen, lernen auf dem Versuchsfeld. Anschließend sollen dann sieben kleine Felder gemeinschaftlich bebaut werden. Die Felder waren eigentlich die vor den armseligen Häusern liegenden „Höfe“ verschiedener Familien. Diese haben sich bereit erklärt ihr Land für den Anbau herzugeben. Die Gemeinde musste aber zuerst noch das teilweise abgesunkene Land in gemeinschaftlicher Arbeit absichern und vom angesammelten Müll säubern.
Die Arbeit wurde von der Stadtteilinitiative „Ateneo Caribes de Itagua“ organisiert, die auch das Gemüseanbau-Projekt in den Stadtteil holte.
„Unsere Arbeit im Stadtteil ist viel älter als die Chávez-Regierung, wir arbeiten hier seit 20 Jahren“, erklärt Edgar Pérez von der Initiative, „aber wir unterstützen unseren Präsidenten, denn unsere Arbeit wird von der Regierung unterstützt, auch wenn wir nicht in die Regierungspartei MVR (Bewegung V. Republik) eingetreten sind“. Edgar Pérez bezeichnet sich selbst als libertär, sein Ansatz sei die Politik der täglichen Praxis. „Politik bedeutet das eigene Leben zu organisieren und mit dieser Regierung ist Politik auch keine Expertensache mehr wie es früher immer dargestellt wurde. Heute ist klar, dass man keinen Doktortitel in Soziologie braucht, um über Politik zu reden“, unterstreicht Pérez. Die Forderungen der Stadtteilversammlungen seien heute Regierungspolitik. „Wir haben für unsere Arbeit drei zentrale Achsen ausgemacht: Erziehung, Gesundheit und Ernährung. Die drei zentralen Programme der Regierung decken genau diese drei Bereiche ab!“, so Pérez begeistert. Neben der Förderung der urbanen Landwirtschaft ist die Regierung gerade dabei ein staatliches Verkaufsnetz für stark preisreduzierte Lebensmittel und Medikamente, „Mercal“, in Armenvierteln und marginalisierten ländlichen Gegenden aufzubauen.
Kubanische Ärzte
Im Rahmen des Programms „Barrio adentro“ sind 500 kubanische Ärzte in die Armenviertel geschickt worden, um einige Monate lang die Bevölkerung medizinisch zu betreuen und Vorsorgeuntersuchungen vorzunehmen. Die Opposition ist erzürnt und schimpft gegen die Kubaner, Venezuela habe selbst genügend Ärzte. Die betroffene Bevölkerung ist hingegen begeistert, denn die venezolanischen Ärzte waren bisher nicht bereit, in diesen Stadtteilen zu leben und dort medizinische Dienste zu leisten. Auf drei öffentliche Aufrufe in dem Programm mitzuarbeiten meldeten sich nur 80 venezolanische Ärzte. Diese arbeiten nun zusammen mit 500 kubanischen Ärzten, deren Anzahl bis Ende des Jahres auf 1 000 wachsen soll. Sie sollen zwei Jahre in Venezuela bleiben, anschließend ist geplant das Programm ausschließlich mit venezolanischem medizinischen Personal fortzusetzen. Hunderte von Jugendlichen aus den ärmsten Vierteln Caracas studieren bereits seit einigen Jahren, mit Stipendien versehen, Medizin auf Kuba und in Venezuela.
Die Bewohner der Armenviertel sind nicht nur glücklich über die Anwesenheit der Ärzte, sondern auch sichtlich stolz darauf. Mit gutem Grund. Die Voraussetzung für die Einrichtung der Behandlungszentren ist, dass aus der Gemeinde selbst ein Behandlungszimmer, ein Wartezimmer und eine Unterkunft für den Arzt gestellt werden. Die Regierung stellt kostenfrei die Materialien für die Renovierung, doch die Arbeit muss von den Bewohnern des Stadtteils geleistet werden. Zusätzlich bauen diese auch ein Unterstützungsnetz für die Ärzte auf, um diese in der Präventionsarbeit zu begleiten. In gut organisierten Stadtteilen übernehmen meist schon seit Jahren vorhandene Basisorganisationen diese Aufgaben, in anderen ist es oft die erste Selbstorganisation, die entsteht. Im Stadtteil Carretera Vieja/Plan de Manzano, Sektor Las Torres, ebenfalls im Distrikt Libertador, hat ein altes Ehepaar den vorderen Teil seines Hauses für eine Arztpraxis hergegeben. Die Anwohner haben alles sauber gemacht, frisch gestrichen und der kubanischen Ärztin ein kleines Zimmer hergerichtet. Während diese gerade ein Kind mit Bauchschmerzen untersucht, sitzt die nächste Patientin, eine junge Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht, bereits im Wartezimmer. „Ich war schon mehrmals hier, alleine und mit meinen Kindern,“ erzählt Odali. „Diese Ärztin ist ein Segen! Früher hatten wir hier keinen Arzt und nachts war es völlig unmöglich medizinische Hilfe zu bekommen. Bei ihr war ich schon zweimal nachts mit meinen Kindern und meinem Mann hat sie das Leben gerettet, als er im Januar eines Nachts mit einer schweren Viruserkrankung von einem Hospital in der Stadt abgewiesen wurde, weil die Oberärzte dort den Oppositionsstreik unterstützten.“ Sie kann die Kampagne der Oppositionsmedien gegen die Ärzte nicht verstehen. „Das ist völlig unverantwortlich, das Fernsehen versucht uns davon zu überzeugen nicht zu den kubanischen Ärzten zu gehen, sie seien schlecht und außerdem Kommunisten, erzählen sie, aber die Alternative bedeutet nicht zum Arzt zu gehen, sie spielen mit unserem Leben“. „Meine Schwiegermutter glaubte den Medien und versuchte auch uns zu überzeugen nicht zum Arzt zu gehen, aber mittlerweile kommt sie regelmäßig hierher, seit sie einmal krank war und ihr nichts anderes übrig blieb, als hierher zu kommen, hat sich ihre Meinung gründlich geändert“.
Auch die kubanischen Ärzte können die Kampagnen der Oppositionsmedien nicht nachvollziehen. Maria Elena Alfonso kam wie alle anderen freiwillig nach Venezuela. „In den Stadtteilen wurden wir wunderbar empfangen, wir fühlen uns wie zu Hause“, strahlt sie und berichtet weiter „ich habe mich aus rein humanistischen Gründen für den Dienst hier gemeldet. Als Ärztin will ich armen Menschen helfen, die ansonsten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und das ist hier der Fall. Am häufigsten haben wir es mit Atemwegs- und Durchfallerkrankungen zu tun und die sind zum Großteil der Armut geschuldet“. Selbst die Behauptung der Opposition, es handele sich um ein Programm zur kommunistischen Infiltration Venezuelas, ist absurd. Das gleiche Programm lief auch Jahre in Guatemala und anderen lateinamerikanischen Ländern, deren Regierungen sicher über jeden Verdacht, linke Sympathien zu hegen, erhaben sind.
Bildung ist ein absoluter Schwerpunkt der Chávez-Regierung. Der Posten für Bildung im Staatshaushalt ist seit seinem Amtsantritt von unter 2,8% des BIP auf 6,4% (2001) angehoben worden und er steigt weiter. Über eine Million Kinder wurden neu in das Schulsystem integriert. Die meisten über die neu eingerichteten „Bolivarianischen Schulen“, in denen nach der befreiungspädagogischen Methode von Frei Betto unterrichtet wird, dazu gibt es Spiele, Kultur, Sport und vor allem eine Mahlzeit, was es vielen armen Kindern erst ermöglicht die Schule zu besuchen. Dafür wurden bis Ende letzten Jahres im ganzen Land 675 neue Schulen gebaut, 2 250 teilweise geschlossene Schulen renoviert und 36 000 neue Lehrer eingestellt, sowie angehäufte Lohnschulden alter Regierungen bezahlt. Am 1. Juli begann mit der „Misión Robinson“ ein ehrgeiziges Alphabetisierungsprogramm. Basierend auf der Befreiungspädagogik wurde das ursprünglich kubanische Modell der venezolanischen Realität angepasst. Als es begann, verkündete Chávez noch, man wolle in einem Monat eine Million Menschen alphabetisieren. Ganz so schnell verlief es doch nicht, denn die Kurse haben eine Dauer von sieben Wochen. Bis Mitte September erlernten immerhin in zwei Durchgängen insgesamt 300 000 Menschen das Lesen und Schreiben. Weitere 700 000 sollen in den nächsten Monaten folgen.
Zehntausende Freiwillige unterrichten die Lernwilligen nach der Methode „Ja, ich kann“. In den Kursen sitzen Teilnehmer jeden Alters, von Neunjährigen, die aus Armut keine Schule besuchen, bis zu Rentnern, der Älteste immerhin 102 Jahre, die nie zuvor lesen und schreiben gelernt haben. Zum Abschluss bekommt jeder ein Zertifikat und eine „Familienbibliothek“, eine Sammlung mit 25 Werken der Weltliteratur, darunter Pablo Neruda, William Shakespeare, Jack London, William Faulkner und venezolanische Literatur. „Misión Robinson“ erwies sich als derart erfolgreich, dass die brasilianische Regierung Anfang Oktober verkündete, ebenfalls eine Alphabetisierungskampagne nach dem gleichen Muster durchführen zu wollen.
Ende Oktober läuft unter dem Namen „Ja, ich kann weitermachen“ die zweite Phase von „Mission Robinson" an. Ein Schulabschluss, für den Grundkenntnisse in Geschichte und Geografie, Naturwissenschaften, Mathematik, Englisch und sogar im Umgang mit Computern gelehrt werden. Im November eröffnen auch die ersten „Bolivarianischen Universitäten“, ein neues Hochschulsystem, in dem all jene unterkommen sollen, die sich bisher das Studium an den kostspieligen Privatuniversitäten nicht leisten konnten und auch zu der elitären Zentraluniversität keinen Zugang fanden. Und das sind sehr viele, denn nur etwa zehn Prozent der Abiturienten Venezuelas schaffen es schließlich auf eine Hochschule. Ende September baute die Regierung mit Hilfe tausender Freiwilliger an einem Sonntag 1 600 ambulante Immatrikulationsbüros im gesamten Land auf. Hier konnten sich alle, die einen Studienplatz wollen, mit Namen, Adresse, Informationen über den Schulabschluss und Studienwünschen in vorgedruckte Bögen eintragen. Auf dieser Grundlage werden die Bolivarianischen Universitäten dem Bedarf entsprechend geplant. Allein an diesem einen Tag meldeten sich 460 000 Studierwillige und ihre Zahl steigt nach wie vor, denn in einigen Institutionen und im Internet sind die Formulare immer noch zu haben. 300 000 von ihnen bekommen ein Stipendium von umgerechnet 100 Dollar monatlich. Das reicht zwar auch in Venezuela nicht zum Leben, bildet für viele Mittellose aber dennoch eine Grundlage, die ihnen das Studium erst ermöglicht.
Die Opposition verflucht die verschiedenen Programme als Propaganda und wirft Chávez Populismus und Wählerfang vor. Edgar Pérez aus Las Casitas sieht das anders. „Populismus haben alle vorherigen Regierungen betrieben, sie verteilten Staatsgelder und staatliche Hilfen als Almosen getarnt vor allem in der Vorwahlzeit und auch nur an ihre Parteianhänger. Chávez macht nur das, was er versprochen hat und wofür wir ihn gewählt haben: Er teilt den Reichtum des Landes mit den Armen und niemand musste dafür bisher in irgendeine Partei oder Organisation eintreten.“