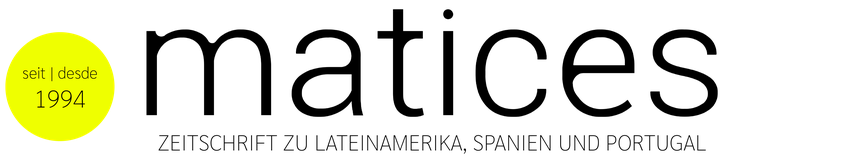Tradition: Inidaner umlegen
Interview mit Rüdiger Nehberg
von Miriam Lang
Der als Survival-Experte und durch seine medienwirksamen Aktionen für die Yanomami-Indianer bekannte Rüdiger Nehberg gründete 1997 seine eigene Menschenrechtsorganisation. Im April 2002 beendete er sein jüngstes Projekt, die Errichtung einer Krankenstation für die Waiapí-Indianer im brasilianischen Regenwald. Mit „Sir Vival“ (so sein selbstgewähltes Synonym) sprach für Matices Eva C. Hammel.
Mein Eindruck ist, dass weder die nicht-indianische Bevölkerung noch die Regierungen Südamerikas irgendein Interesse an den in ihren Staaten lebenden indígenas haben. Können Sie diesen Eindruck für Brasilien bestätigen?
Nehberg: Ja, weil da für die Politiker und die Geschäftsleute einfach noch viel zu holen ist. Ob jetzt unverkauftes Land oder Holz und Bodenschätze. Da fehlt in Wirklichkeit das politische Interesse, den Indianern zu helfen. Man will sie aufsaugen und Land frei machen für Großgrundbesitzer. Zunächst schickt man gerne die armen Schlucker rein, die sich ein Stück Land urbar machen, und dann kommen die Großgrundbesitzer gleich nachgerückt und vertreiben die Kleinen. Also, ich denke, das ist in ganz Lateinamerika so und nicht auf Brasilien beschränkt.
Die Feinde der Indianer sind wer - die Politiker, die Goldsucher, die Touristen...?
Nehberg: Ich denke in erster Linie die Politiker. Die benutzen die Touristen und die armen Schlucker aus den Elendsvierteln als Werkzeug, um dann vorzudringen und die Kulturen zu vermischen. Damit sie nachher leichteres Spiel haben. Denn es wird oft argumentiert in Brasilien: wie kommen wir dazu, so wenigen Indianern so viel Land zu geben, während die armen Leute in den Elendsvierteln gestapelt wohnen?
Wo leben die Waiapí, bei denen Sie zuletzt waren?
Nehberg: In Nordost-Brasilien, an der Grenze zu Französisch- Guyana.
Wie sieht deren Gemeinschaft aus und wodurch zeichnet sich die Lebensweise aus?
Nehberg: Es ist ein kleines Volk, keine 2.000 Leute. Die Größe des Gebietes müsste ich jetzt aber schätzen, vielleicht halb so groß wie Schleswig-Holstein. Wunderschöner, ursprünglicher Wald.
Wie sind sie auf die Waiapí gestoßen?
Nehberg: Ich habe die Waiapí zufällig kennen gelernt, als ich mit einem Bambusfloß über den Ozean gefahren bin anlässlich der 500-Jahr Feiern. Da musste ich eine Notlandung zusammen mit meiner Partnerin machen. Mich beeindruckte, dass viele von ihnen schon Kontakt zur brasilianischen Zivilisation gehabt, ihn aber nicht gut gefunden hatten. Sie besannen sich zurück auf ihre Lebensform und entschlossen sich dann, dort zu siedeln. Mit Hilfe der deutschen Regierung wurde das Land damals gekauft und ihnen dann zugesprochen. Alle, die dort leben, sind verpflichtet, in der ursprünglichen Weise zu leben, zum Beispiel was die Kleidung angeht – sie tragen Lendenschurze. Und wem das nicht passt, der muss raus. Sie siedeln traditionell in kleinen Hütten, familienweise, nicht wie die Yanomami alle unter einem Dach. Sie pflegen ihren Ackerbau, das sind vor allem Bananen und Maniok, und leben sehr viel vom Sammeln. Weil der Wald dünn besiedelt ist, bietet er den Leuten genug.
Sie können also bestätigen, dass die Waiapí sehr selbstbewusst im Umgang mit ihrer Tradition und den Weißen sind?
Nehberg: Ja, bei der Gruppe, für die wir die Krankenstation gebaut haben, hatte ich den Eindruck, dass sie ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Sie sind leider, wie das bei vielen Völkern ist, untereinander zerstritten und in zwei Parteien gegliedert. Dies wird von einer belgischen Ethnologin noch forciert, weil sie eine Gruppe der Indianer auf ihre Seite ziehen möchte, um Gold zu bergen.
Sie haben zwei Organisationen gegründet und haben ein Büro in der Stadt Macapá, im Bundesstaat Amapá, in dem das Waiapí-Gebiet liegt. Die Waiapí haben unter anderem auch erkannt, wie wichtig Bildung ist; sie wollen nicht rückständig sein, sondern Portugiesisch sprechen, das ja nun einmal die Sprache ihrer Kontrahenten ist.
Wie kamen Sie zu ihrem Projekt, und warum entschieden Sie sich für eine Krankenstation?
Nehberg: Die Waiapí wollten eine Krankenstation haben, weil die existierende am Eingang des Reservats „verludert“ war. Wir sind damals mit der Indianerbehörde FUNAI von Dorf zu Dorf gegangen, um zu hören, welche Wünsche es gab und haben uns dann entschieden, diese Station zu bauen.
Also eine ideale Konstellation – die Indianer kamen auf Sie zu und Sie griffen ihre Wünsche auf.
Nehberg: Ja, und damit die andere Gruppe nicht neidisch wird und der Streit nicht eskaliert, haben wir ihr ein gutes Motorboot gegeben, mit dem sie Schüler zu Schulen und Kranke in Krankenhäuser fahren kann. Die FUNAI hatte das auch so überlegt. Dieses Boot wird von der FUNAI betrieben, damit die Indianer damit nicht ständig rumgurken und alles kaputt machen.
Wie war der Verlauf des Projekts und über welchen Zeitraum erstreckte sich die Realisierung?
Nehberg: Der Entscheidungsprozess zog sich hin, weil die Behörde so lahmarschig war. Nach wechselnden Zu- und Absagen hat sich die Indianerbehörde verpflichtet, die Kosten für die Krankenschwester und die Medizin zu übernehmen; ich habe mich verpflichtet, die Wartung zu übernehmen. Der Bau der Station dauerte drei Monate. Es ist ein sehr schönes Haus geworden.
Sie sagen auf Ihrer Webpage, die Station sei klein und zweckmäßig - was kann ich mir darunter vorstellen?
Nehberg: Garantiert gibt es dort kein Röntgengerät und solchen Luxus, denn wenn Fälle ernst sind, kann man sie nach Macapá fahren. Alles, was ambulant behandelt werden kann, bis hin zu Malaria, wird auf der Station behandelt. Der traditionelle Teil der Medizin wird von den Dorfältesten, den Schamanen gemacht. Der ist nicht im Haus ansässig, das machen sie im benachbarten Dorf. Erst wenn sie nicht weiterkommen, wie bei Krankheiten, die von Weißen eingeschleppt wurden, wenden sie sich an die Krankenschwestern.
Wie wird die Station geführt?
Nehberg: Ursprünglich war nur eine Schwester geplant. Aber als wir das Haus einweihten und die FUNAI dabei war, waren sie so begeistert von dem gelungenen Haus, dass sie entschieden haben, die andere Station zu schließen und zwei Schwestern im Wechsel dort tätig sein zu lassen.
Wir haben jetzt den Auftrag, ein zweites Holzhaus daneben zu setzen.
Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der brasilianischen Regierung? Ich war überrascht zu lesen, dass eine Kooperation stattgefunden hat.
Nehberg: Da war ich selbst überrascht! Ständig wechseln die Beamten in der Behörde, der eine sagte „Hü!“, der andere „Hott!“. Es war vor allem unser Mann vor Ort, der immer wieder vorstellig wurde und unsere Forderungen dann auch durchgekriegt hat. Die FUNAI ist auch keine homogene Behörde. Ich habe schon viel schlechtere Erfahrungen mit ihr gemacht, hier aber hat es relativ reibungslos geklappt.
Muss man den Gedanken hegen, dass solche gelungenen Projekte von der Regierung als Vorzeigeprojekte verwendet werden?
Nehberg: Könnte gut sein, ja. In diesem Fall war es so, dass sie von sich aus sagten, das Ergebnis sei schöner und besser geworden, als sie erwartet hätten.
Es ist also notwendig, den Kontakt zu halten, um Stabilität zu gewährleisten?
Nehberg: Ja, und die Möglichkeit zu nutzen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn generell geht es mit den Indianern den Bach runter. Wenn aber das, was man getan hat, von den Medien positiv bewertet wird, sonnen sich die Politiker natürlich auch gern in den Erfolgen, die in ihren Wahlkreisen stattfinden.
Was können wir Europäer von den Indianern lernen?
Nehberg: Was ich gut fand ist, dass es keine Hektik gibt. Es gibt auch keine Überbevölkerung. Im Durchschnitt haben die Frauen zwei Kinder, dann hören sie auf. Sie verstehen es, sich zeitweise oder auf Dauer unfruchtbar zu machen. Das wird dann vom Stamm beschlossen.
Dadurch haben sich Menschen und Natur auf ein Gleichgewicht eingependelt. Das sind so ein paar Dinge, die mich beeindruckt haben. Kein Altersheim. Man stirbt in der Gemeinschaft.
Glauben Sie, dass der Prozess der Zerstörung der Lebensweise der Regenwaldindianer unausweichlich ist?
Nehberg: Ja. Weil die Rücksichtslosigkeit stärker ist als die Vernunft.
Man kann also nur versuchen, den Übergang so sanft wie möglich zu gestalten und die Völker so stark wie möglich zu machen?
Nehberg: Ganz genau. Wir hatten damals bei den Yanomami das Gefühl, dass wir keine Chance hatten, diesen Völkermord und die Zerstörung aufzuhalten. Weil da 65.000 Goldsucher gegen 10.000 Yanomami standen. Die Goldsucher werden mit Versprechungen von Reichtum hineingelockt, dann aber skrupellos ausgebeutet. Da gibt es kein Mitleid und keinen Kredit. Das ist wie im Wilden Westen vor 200 Jahren.
Manche tragen demonstrativ eine Kombizange am Gürtel. Die nennt man die Zahnärzte. Sie sagen, schneller als an einer Leiche kann man Gold gar nicht finden - und brechen ermordeten Goldsuchern die Zähne raus. Nach wie vor ist es Tradition, dass sie Indianer umlegen und damit prahlen, Pistenmeister zu sein: die meisten Kerben für tote Indianer im Waffengriff zu haben.
Haben Sie darüber hinaus eine persönliche Erkenntnis durch den Umgang mit den Waiapí gewonnen?
Nehberg: Ich habe erkannt, dass jemand, der unbedingt helfen möchte und Organisationen nicht traut, ein kleines Projekt selbst machen kann, ob nun im Regenwald oder anderswo.