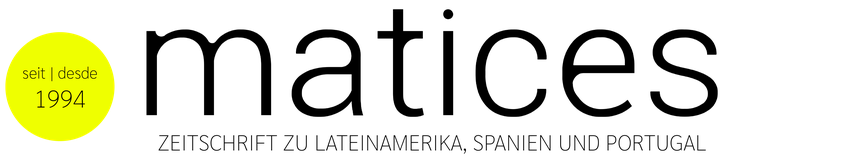Kolumbiens neuer Präsident Álvaro Uribe Vélez
„Demokrat mit Autorität“?
von Linda Helfrich-Bernal
Am 26. Mai 2002 wurde Álvaro Uribe Vélez mit 53 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten Kolumbiens gewählt. Eine Wahl- und Personenanalyse geben Aufschluss darüber, was das Land in puncto Demokratisierung von Uribe zu erwarten hat.
Was mag Uribe wohl meinen, wenn er sich selbst als „Demokrat mit Autorität“ beschreibt und von einem „demokratisch-autoritären“ System spricht, das er für Kolumbien anstrebt? Bisher war sich die Forschung äußerst uneinig darüber, um welche Art von Regime es sich bei dem Andenstaat handelt. In der Encyclopedia of Democracy von 1995 weist Hartlyn (1995: 258) stellvertretend für viele andere darauf hin, dass Kolumbien systemtheoretisch schwer einzuordnen sei. Egal, ob man sich nun darauf versteift, den Andenstaat als Demokratie zu preisen, die demokratischen Defizite aufzuzeigen, das Regime als hybrid zu beschreiben, es in die Nähe einer Autokratie rückt oder gar den Staatszerfall befürchtet – eines steht fest: Bereits vor und während der Wahl deutete sich an, dass von der Präsidentschaft Uribes kaum demokratisierende Impulse in den nächsten vier Jahren zu erwarten sind.
Demokratische Legitimität der Wahlen
Laut der 50 vom ehemaligen kolumbianischen Präsidenten und OAS-Chef César Gaviria entsandten Wahlbeobachter verlief die Wahl „normal“ und „transparent“. Politiker und Journalisten überboten sich ebenso wie ausländische Regierungschefs, den „Sieg der Demokratie“ über die Gewaltakteure hervorzuheben und zu „belegen“. Allein in 11 der 1.098 Gemeinden des Landes verhinderte die Guerilla die Wahlen.
Innenminister Armando Estrada betonte, dass „nur“ 23.000 Menschen nicht die Wahlurne aufsuchen konnten. Abgesehen von der Verletzung des demokratietheoretisch wichtigen Konzeptes der Gleichheit der Partizipationschancen, werden bei Zugrundelegung eines anspruchsvollen Konzeptes zur Evaluierung demokratischer Wahlprozesse sofort die Defizite deutlich. Würden die BeobachterInnen nicht nur den Wahltag berücksichtigen, sondern den Zeitraum des Wahlkampfes bis zum Wahlfeststellungsverfahren in den Blick nehmen, müsste die Beurteilung kritischer ausfallen. Denn dann spielten Indikatoren eine Rolle wie die Freiheit und Chancengleichheit bei der Wahlbewerbung, die Existenz des Wettbewerbs, die korrekte Wahlorganisation, -verwaltung und -überwachung, der Beitrag der Wahlen zur politischen Machtverschiebung und das Vorhandensein einer demokratischen Wahlmethode. Die mangelnde Bewegungsfreiheit der Präsidentschaftskandidaten bis hin zu Attentaten und der Entführung Ingrid Betancourts, die unterschiedliche Beziehung der Kandidaten zu den Massenmedien, die unzureichende finanzielle Ausstattung mancher Wahlkampagnen, die mangelnde Offenlegung und Transparenz der Wahlkampffinanzierung, die Existenz von Großspendern, die zunehmenden Klagen über Wahlbetrug sowie die Einschüchterung oder gar direkte Bedrohung und Beeinflussung von Wählern durch die Gewaltakteure beschreiben die andere Seite der Medaille. Diese Wählereinschüchterung drückte sich u.a. in einer Wahlenthaltung in den departamentos Chocó und Amazonas mit bis zu 70 Prozent aus, während der nationale Durchschnitt bei etwas über 53 Prozent lag.
Doch obwohl Defizite im Wahlverlauf aufgezeigt werden konnten, betonten die Medien nach der Wahl gerade die umfassende Legitimation des künftigen kolumbianischen Präsidenten. Sie begründeten dies mit dem großen Zuspruch der Bevölkerung, der seinen Sieg im ersten Wahlgang ermöglichte. Der eindeutige Wahlsieg Uribes im ersten Wahlgang mag oberflächlich betrachtet die Regierbarkeit Kolumbiens erhöhen. Ein zweiter Wahlgang stärkte in der Vergangenheit jedoch das politische Gewicht kleinerer Parteien. Diese suchten durch Verhandlungen mit den beiden zur Wahl stehenden Kandidaten ihren politischen Vorstellungen Geltung zu verschaffen. Hierbei besteht zwar die Gefahr des Klientelismus, der sich im kolumbianischen System meist in Ämterpatronage ausdrückt. Allerdings wird den von der Regierung ausgeschlossenen politischen Kräften auch die Chance eröffnet, auf die künftige Politik Einfluss zu nehmen. Demokratisierende Impulse, im Hinblick etwa auf die konkrete Ausrichtung der seit langem diskutierten und strittigen politischen Reformen sowie auf den Rechtsstaat und den Friedensprozess, hätten bei einer Stichwahl von den politischen Gruppierungen um den Polo Democrático Lucho Garzóns und um die Partei Ingrid Betancourts eingebracht werden können.
Der “unabhängige“ Uribe?
Solange es verboten war, für andere Parteien zu kandidieren bzw. erfolgversprechend im Namen der traditionellen Parteien zu Wahlen anzutreten, um die Macht im Staat zu erobern bzw. Herrschaft zu sichern, engagierten sich die meisten Politiker im Partido Liberal Colombiano (PLC) oder im Partido Conservador Colombiano (PC). Nach den Reformen der 80er und 90er Jahre entstanden vor allem aus der Mitte der traditionellen Organisationen eine Reihe von Abspaltungs- und Satellitenparteien. Die Entscheidung verschiedenster Präsidentschaftskandidaten seit den 90er Jahren, sich entweder von den traditionellen Parteien ganz zu trennen oder in einer satellitenartigen Beziehung zu verweilen, hing von deren Einschätzung der strategischen Vorteile der jeweiligen Vorgehensweise ab. Uribe hatte bereits in Antioquia als „Dissident“ gute Erfahrungen bei der Abnabelung vom liberalen Kaziken Bernardo Guerra Serna gemacht. Unter dessen Protektion war er 1984 erstmals zum Stadtrat von Medellín gewählt worden. Das vorübergehende Ausscheren liberaler Kandidaten vom offiziellen Liberalismus ist ein alt bekanntes Phänomen, das lediglich durch die erleichterten Möglichkeiten zur Parteigründung ein neues Gesicht erhalten hat – alter Wein in neuen Schläuchen also! Uribe gründete zunächst die Stiftung Primero Antioquia, die er dann in Primero Colombia umwandelte, um sie auf der nationalen Ebene als Wahlorganisation zu etablieren. Dort nahm er alle bereitwillig auf, die seine Vorstellungen eines „demokratisch-autoritären Systems“ teilten. Ob sich Horacio Serpa in der Parteispitze des PLC behaupten kann, oder, wie der einflussreiche Ex-Präsident López Michelsen fordert, eine kollektive Führung erzielt werden wird, hängt in erster Linie davon ab, wie viel Druck liberale Politiker auf Serpa ausüben werden, damit sich der heutige Parteichef stärker zurücknimmt. Das Anbiedern liberaler Politiker, die Uribe nicht bereits vor der Wahl unterstützt hatten, begann unmittelbar danach. Es verdeutlicht, dass die Flügelkämpfe innerhalb der Partei weniger nach ideologischen als nach Gesichtspunkten der Macht entschieden werden.
Wichtiger allerdings als die Parteizugehörigkeit waren schon immer, und dies gilt nach der zunehmenden Verwischung der Parteikonturen noch stärker für die nahe Zukunft, die jeweiligen, hinter den Politikern stehenden, sozialen und ökonomischen Kräfte. So kann es sich keinesfalls nur um eine Imageaufbesserung gehandelt haben, wenn Uribe sich für den vermeintlichen „Menschenrechtsaktivisten“ Francisco Santos als Vizepräsidenten entschieden hat. In bestimmten Kreisen gelten die von Santos und seiner Frau gegründeten Stiftungen País Libre und No Más! als Speerspitze der Friedens- und Menschenrechtsbewegung. Doch gibt es auch eine Menge Kritiker, die die Wertvorstellungen hinter dieser Art von Menschenrechtspolitik nicht teilen. Hinter der Entscheidung für Santos steht allerdings viel mehr: Es geht um die Verbindung zwischen Präsidentenamt und der „Santos-Familie“, um das Zusammenführen von medialer, ökonomischer und politischer Macht, das kaum demokratischen Interessen dienen dürfte.
Schlimmer als solche Verbindungen sind allerdings die Uribe und seiner Familie vorgeworfenen Beziehungen zu dubiosen Großgrundbesitzern, Kontakte zu in Menschenrechtsverletzungen verstrickten Militärs, Drogenhändlern und deren Söldnertruppen. Auch wenn sich Uribe davon distanzierte, der Kandidat der Paramilitärs zu sein, feierten diese ihn umgekehrt als ihren Präsidenten, wie sie es zuvor bereits mit 30 Prozent der Kongressabgeordneten getan hatten. Mag Uribe auch selektiv und als Vorzeigeaktion gegen einzelne Paramilitärs vorgehen, so ist es wohl kaum realistisch anzunehmen, dass ein Präsident seine Unterstützerbasis zerstört.
Gefahren für Rechtsstaat und Friedensprozess?
Wenn Uribe von „demokratisch legitimierter Autorität“ spricht, dann heißt das im schlechtesten Fall, dass er Mittel und Wege suchen wird, rechtsstaatliche Grundsätze, wie sie die Verfassung vorsieht, zu umgehen. Diese autoritären Akte wird er dann mit der ihm durch demokratische Wahlen vom Volk zugesprochenen Legitimation zu rechtfertigen suchen. Die Durchsetzung seines im Wahlkampf zentralen „Law-and-order-Programms“ kann in der vorgesehenen Form nur mit einer Einschränkung rechtsstaatlicher Garantien umgesetzt werden. Die Erhöhung der Militärausgaben, die Verdoppelung der Streitkräfte, eine Politik der harten Hand gegenüber der Guerilla und die Verschärfung der „Anti-Terrorgesetze“ deuten nicht auf eine Stärkung der rechtsstaatlichen Teilregimesegmente einer Demokratie hin. Vor allem die zum Teil bereits seit Jahren stillschweigend vollzogene, aber nun auch offiziell und auf nationaler Ebene geförderte Aufhebung der Trennung zwischen staatlichen und privaten „Sicherheitskräften“ ist mit einer Demokratie nicht vereinbar. Die Gründung von Metroseguridad in Medellín und die Legitimierung der “Bürgerwehr” CONVIVIR sowie die vom damaligen Innenminister Serpa bewilligte Bewaffnung mit „defensiven“ Waffen und der Vorschlag Uribes, noch als Gouverneur von Antioquia, die CONVIVIR mit „offensiven“ Waffen auszurüsten, waren erste Schritte in diese Richtung. Während Uribe und seine Anhänger die damit im departamento Antioquia erzielten „Erfolge“ lobten, hoben seine Kritiker – wie beispielsweise die UN-Menschenrechtsbeauftragte Mary Robinson – die wachsende Zahl der Menschenrechtsverletzungen und die Übergriffe der CONVIVIR hervor sowie deren „Zusammenarbeit“ mit Paramilitärs und staatlichen Sicherheitskräften. Der Vorschlag Uribes, nun die Probleme des hybriden kolumbianischen Rechtsstaates einer 100.000 Mann starken „Bürgerwehr“ zu überantworten, statt für dessen Stärkung auf zivilem Wege zu sorgen, kann nur als Schritt gewertet werden, der die Funktion der staatlichen Sicherheitskräfte weiter aushöhlt, die Gefahren des Amtsmissbrauchs erhöht und die Verfolgung und zum Teil auch die „Bestrafung“ von Gewalttätern auf private Akteure verlagert.
Hinzu kommt die nun auch offiziell angestrebte Aufhebung der Trennung der (nach dem 11. September so bezeichneten) „Anti-Terror-“ und „Drogenbekämpfungspolitik“ durch die stärkere finanzielle Involvierung der USA in den Antisubversionskampf. Damit werden die für den „Kampf gegen die Mafia“ vorgesehenen Gelder umgeleitet. Dies erfordert ein „Zu-Ende-Denken“ der dafür geschaffenen Begründungsformel der narcoguerrilla und neuerdings des „Terrorismus“. Dabei geht es nicht um die Frage, ob es sich bei den beiden Guerillagruppen FARC und ELN um „Terroristen“ handelt oder nicht, oder ob sie sich durch den Drogenhandel finanzieren oder nicht. Es geht vielmehr darum, dass die Anwendung dieser „diskursiven Konzepte“ dazu dient, ein verstärkt militärisches Vorgehen, die Erhöhung von Militärhaushalten und die selektive Bekämpfung von Gewaltakteuren zu begründen.
Uribe steht nicht für einen Weg, der über die Demo-kratisierung des politischen Systems den Frieden sucht. Mit Ausnahme der Bekämpfung der Korruption sprechen seine diesbezüglichen Vorschläge entweder die Sprache der Gewalt oder sie lassen, wie etwa die Einführung eines Ein-Kammer-Parlaments unter dem Vorwand der Korruptionsbekämpfung und der Haushaltssanierung, eine Aushöhlung demokratischer Institutionen und Kontrollmechanismen erahnen. Ob der Präsident seinem, bei Menschenrechtlern schlechten Image, treu bleiben wird oder doch noch etwas demokratische Phantasie zu entwickeln vermag, kann nur die Zukunft zeigen.