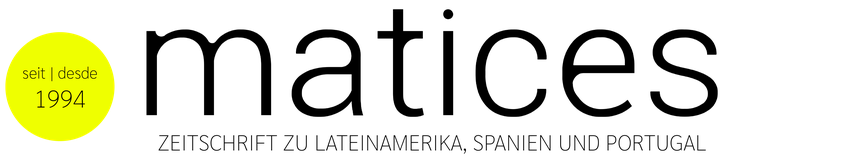Indigener Widerstand gegen Privatisierung und Profit
von Miriam Lang
Viele lateinamerikanische Staaten sind in den letzten Jahren mit einer neuen Form von indigenem Widerstand konfrontiert. Die Ureinwohner opponieren mit ihren Forderungen direkt gegen neoliberale Grundprinzipien, was sie mit der westlichen Antiglobalisierungsbewegung verbindet.
Glaubt man dem National Intelligence Council (NIC), einem Strategie-Team innerhalb des US-Geheimdienstes CIA, so stehen die Vereinigten Staaten von Amerika einer neuen Bedrohung aus dem Süden gegenüber: Dem in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern wachsenden Widerstand der indianischen Ureinwohner. In seinem Grundsatzpapier ‚Global Trends 2015‘ konstatiert der NIC: „Diese Bewegungen haben großen Zuwachs zu verzeichnen. Erleichtert wird dies durch transnationale Netzwerke von Aktivisten, die für die Rechte der indígenas eintreten, und durch internationale, gut finanzierte Menschenrechts- und Ökologiegruppen. [...] Die Spannungen im Gebiet von Mexiko bis über die Amazonas-Region werden sich verschärfen."
Zehn Prozent aller Bürgerinnen und Bürger Lateinamerikas sind indianischer Abstammung. In manchen Regionen wie Südmexiko, Mittelamerika und der Andenregion machen sie allerdings bis zu 70 Prozent der Bevölkerung aus, verteilt auf insgesamt etwa 400 ethnische Gruppen. Aufstände der indianischen Bevölkerung hat es in Lateinamerika seit der gewaltsamen Kolonisierung des Kontinents ab 1492 immer wieder gegeben. Doch unterscheiden sich die neuen Proteste von ihren historischen Vorläufern durch ihren Organisationsgrad und ihre Artikulationsfähigkeit: Heute werden konkrete Forderungen gestellt, die von regionalen, nationalen und internationalen Organisationsstrukturen getragen werden. Diese Forderungen werden auf der politischen sowie auch auf der nationalen und internationalen juristischen Ebene bis zu den höchsten Entscheidungsebenen durchgefochten.
Im Zuge der Proteste zum 500-jährigen Jahrestag der Eroberung 1992 sind kontinentale Strukturen entstanden, die dem Widerstand der Ureinwohner zu mehr Sichtbarkeit und Durchsetzungsvermögen verhelfen. Die neuen Widerstandskollektive nennen sich selbstbewusst pueblos indios und eignen sich damit einen ursprünglich abwertenden Kolonialbegriff an, indem sie ihn umdeuten und zum Mobilisierungsfaktor machen. Der Begriff indio soll das gemeinsame Element der Kämpfe in verschiedenen Ländern hervorheben und den antikolonialen Charakter der Bewegung betonen. Von Chile im extremen Süden bis Mexiko im Norden des Kontinents ähneln sich die Konflikte und die Forderungen: Die Nationalstaaten sollen die multiethnische Zusammensetzung ihrer Bevölkerung anerkennen und ein plurikulturelles Selbstverständnis entwickeln. Sie sollen indianischen Gemeinschaften Autonomie gewähren, das heißt, ihre traditionellen Rechts- und Eigentumsformen anerkennen, auch wenn sie von denen des hegemonialen westlichen Demokratiemodells abweichen. Autonomie meint für die indigenen Aktivisten heute explizit nicht nur symbolische Anerkennung, wie sie von der bisherigen „indigenistischen“ Politik der meisten lateinamerikanischen Regierungen auf einer eher folkloristischen Ebene gewährt wurde, sondern hat einen ganz materiellen Kern: Die Ureinwohner wollen in ihren Gebieten selbst bestimmen, was mit den Ländereien geschieht, wie natürliche Ressourcen genutzt und welche Entwicklungsprojekte durchgeführt werden.
Widerstand vom Rio Grande bis Feuerland
Mit diesen Forderungen stehen sie in einem diametralen Widerspruch zu einigen Kernprinzipien der neoliberalen Markt wirtschaft: Sie bevorzugen Gemeinschafts- vor individuellem Privateigentum, und sie fordern einen nachhaltigen, nicht profitorientierten Umgang mit der Natur. Andererseits ist es die neoliberale Wirtschaftspolitik, welche die indianischen Forderungen nach autonomen Gebieten erst notwendig gemacht hat. Zum einen stehen die Paradigmen von Privatisierung und Individualisierung den kollektiven Produktionsund Landnutzungsformen entgegen, die in vielen indianischen Kulturen praktiziert werden. Zum anderen dringen transnationale Unternehmen auf der Suche nach Biopatenten, Holz oder anderen Ressourcen heutzutage auch in Regionen vor, in denen indigene Gemeinschaften jahrzehntelang unbehelligt gelebt haben, sozusagen in faktischer Autonomie am Rand der jeweiligen Gesellschaften.
In Chile beispielsweise protestieren die Mapuches gegen den Ausverkauf der Ländereien, auf denen sie seit Jahrhunderten von extensiver Landwirtschaft leben, an internationale Holzkonzerne. Diese vernichten binnen kürzester Zeit riesige Flächen uralter Wälder für die Produktion von Zellulose, d.h. Karton und Papier. Das chilenische Militärforschungsinstitut CESIM stuft den Widerstand der Mapuches als nationales Sicherheitsproblem ein. Sieben lateinamerikanische Staaten haben inzwischen das vielfältige kulturelle Erbe ihrer Gesellschaften verfassungsrechtlich verankert. In vier Ländern, namentlich Kolumbien, Ekuador, Nikaragua und Panama, wurden darüber hinaus auch bestimmte Gebiete als autonome Territorien festgeschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden derartige Zugeständnisse nur infolge bewaffneter Aufstände gemacht, wie zum Beispiel in Panama 1932 nach dem Aufstand der Kuna-Indianer. Auch in den 80er Jahren kämpften die Miskitos an der nikaraguanischen Atlantikküste noch bewaffnet gegen die sandinistische Regierung - damals noch mit bereitwilliger Unterstützung der USA-, bis die Sandinisten ihnen im September 1987 Autonomie gewährten.
In den 90er Jahren dagegen wurde das extreme Legitimitätsdefizit vieler gewählter Regierungen zur schärfsten Waffe der Indio-AktivistInnen.
Aufgrund verbesserter Bildungssysteme hat sich eine kleine indianische Intelligenzia herausgebildet, die die Mehrheitsgesellschaften mit ihren eigenen Prinzipien zu konfrontieren weiß: Die Indios fordern heute vollwertige Staatsbürgerschaft und prägen neue Vorstellungen von Demokratie, die weit über ihre Gebiete hinaus eine Vorreiterrolle einnehmen. Die mexikanische EZLN mit ihrem sagenumwobenen Sprecher Subcomandante Marcos ist nur das bekannteste Beispiel für diese neue Strategie. So wurden im vom Bürgerkrieg geplagten Kolumbien im Rahmen einer Verfassungsreform 1991 so genannte resguardos eingerichtet, Reservate, die den Kommunen gleichgestellt sind und ebenso wie diese in den Genuss nationalstaatlicher Mittel kommen. Sie werden nach indianischem Recht verwaltet.
In Ekuador schlossen sich bereits 1980 verschiedene Indio-Organisationen zur landesweiten Koordination CONAIE zusammen. Die Organisation hat mittlerweile mit ihren militanten Massenprotesten gegen Korruption, Dollarisierung der Wirtschaft und fehlende Legitimität der herrschenden Politik maßgeblich zum Sturz von zwei Regierungen beigetragen (in den Jahren 1997 und 2000). Die neue Verfassung von 1997, an deren Entstehung die CONAIE beteiligt war, sieht spezielle Wahlkreise für indianische und afro-ekuadorianische Bevölkerungsgruppen vor, in denen Verwaltung, Recht und ökonomische Ressourcennutzung von den indigenen Autoritäten bestimmt werden.
Staaten verweigern Mitbestimmung
Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, greifen die indigenen Gemeinschaften häufig auch zu militanten Mitteln. In Bolivien sind Straßenblockaden und brennende Barrikaden fast an der Tagesordnung. In Venezuela sägten Pemón-Indianer im Amazonasgebiet mehrfach ganze Reihen von Hochspannungsmasten ab, um die Fertigstellung einer geplanten Leitung zwischen Venezuela und Brasilien zu verhindern. In einer Erklärung hieß es: „Der venezolanische Staat, den Sie vertreten, betreibt im Grenzgebiet zu Brasilien ein kommerzielles und industrielles Megaprojekt, dem technologische, ökologische, soziale und ökonomische Werte zugrunde liegen, die unserer Lebensauffassung sowie unseren Vorstellungen der Nutzung und des Besitzes von natürlichen Ressourcen zuwiderlaufen. Das besagte kommerzielle und industrielle Projekt mit seinem Entwicklungsmodell, das der indigenen Kultur diametral widerspricht, soll in den Gebieten umgesetzt werden, die wir seit Urzeiten bewohnen und die von daher die Wiege der Pemón-Kultur darstellen. Das bedeutet, dass dem Pemón-Gesellschaftsmodell ein anderes übergestülpt werden soll.»
Venezuela gab sich 1999 auf Betreiben von Präsident Hugo Chávez eine neue Verfassung. Seitdem müssen mindestens drei Parlamentarier indianischer Herkunft sein. Der seit Ende 1998 amtierende Präsident Hugo Chávez hegt historische Sympathien für die Indígena-Organisationen, da die Ureinwohner den damaligen Oberst schon 1992 bei seinem als „bolivarische Revolution“ bezeichneten Putschversuch unterstützt hatten. So wurde im vergangenen Herbst in Venezuela eine Kommission gebildet, die konkret mit der Demarkation indianischer Gebiete beauftragt wurde, in denen Selbstbestimmung herrschen soll. José Poyo, einer der drei indianischen Parlamentsabgeordneten, erklärt:
„Die Lebensräume der indígenas sind extrem beschnitten worden, was häufig zu Binnenmigration führt. Aus den Bestimmungen über indigene Rechte der neuen Verfassung geht der Auftrag hervor, die indigenen Territorien einzugrenzen. Die Demarkation soll künftig einerseits Flucht- und Migrationsbewegungen zuvorkommen, und andererseits Konflikte vermeiden, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hat, mit Institutionen oder Gemeinden, oder aber mit privaten Unternehmen oder Personen, wie zum Beispiel Bergleuten, Großgrundbesitzern, Viehzüchtern oder auch transnationalen Konzernen, die auftauchen, um die Ressourcen auszubeuten.
Hiermit werden jetzt die Spielregeln für alle festgelegt.“ In Mexiko haben kürzlich mehrere indianische Gemeindevertreter des Bundesstaates Chiapas bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eine Klage gegen das von der Regierung im Frühjahr verabschiedete Indígena-Gesetz eingereicht. Die ILO-Konvention 169 aus dem Jahr 1989, die Mexiko, Venezuela und viele andere lateinamerikanische Staaten ratifiziert haben, ist für die neue Indio-Bewegung eines der wichtigsten Legitimationsinstrumente: sie schreibt auf der Ebene des internationalen Rechts die Mitbestimmung der Ureinwohner über die ökonomische Entwicklung und die Nutzung der Bodenschätze in ihren Gebieten explizit vor. Genau diese Mitbestimmung will der mexikanische Staat den bis 1994 kaum wahrgenommenen Indianern im Süden des Landes aber um jeden Preis verweigern: Die Regierung plant in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Konzernen ein Mega-Entwicklungsprojekt namens „Puebla-Panama- Plan“, das Gebiete vom mexikanischen Süden bis Panama Panama miteinander verbinden soll. Auch hier bilden die territoriale Autonomie und die Bestimmung über die Nutzung der Ressourcen in der Region den Brennpunkt des Konflikts. Der Historiker und Anthropologe Andrés Aubry erklärt in Bezug auf das in Mexiko verabschiedete Autonomiegesetz: „Wie es scheint, ist das Gesetz manipuliert worden, um die Umsetzung des Puebla-Panama-Plans zu erleichtern. Dieser Plan sieht eine Entwicklung der südmexikanischen Region auf der Grundlage der natürlichen Ressourcen vor, die Erdöl, Uranvorkommen, Erdgas und biologische Ressourcen umfassen. Doch ohne diejenigen an diesem Prozess zu beteiligen, die seit Jahrhunderten mit diesen Ressourcen leben und sie schützen: die indígenas.“
Im Frühjahr 2001 war eine Delegation des indianischen zapatistischen Befreiungsheeres EZLN aus dem südmexikanischen Chiapas in einer viel beachteten Rundreise bis in die Hauptstadt marschiert, um ihrer Forderung nach Autonomie Nachdruck zu verleihen. In dem Gesetz über indianische Rechte, das das mexikanische Parlament anschließend verabschiedete, wurde der indianischen Bevölkerung zwar verbal das Selbstbestimmungsrecht zuerkannt, doch wurde der Entwurf so lange verwässert, bis von der Autonomie praktisch nichts mehr übrig war.
Andrés Aubry kommentiert: „Es war die ausdrückliche Absicht der Verfasser des Gesetzes, den Begriff Territorium zu vermeiden: Denn wenn die Autonomie keinen territorialen Ausdruck hat, hängt sie in der Luft. Da kein Territorium zuerkannt wurde, kann man auch nicht die natürlichen Ressourcen festlegen, deren kollektive Nutzung den indígenas zustehen müsste.“
Doch neben der Frage der Ressourcennutzung stehen hier auch verschiedene Modelle von Demokratie zur Debatte, die unterschiedliche ökonomische Implikationen mit sich bringen. In Bezug auf die EZLN erklärt der mexikanische Soziologe Andrés Barreda Marín: „Sie schlagen eine sehr fortschrittliche Demokratie vor, die für alle Gruppen partizipativ ist, und die für die Ökonomie bedeutet, dass alle regionalen gesellschaftlichen Gruppen die Möglichkeit haben, sich an Entscheidungen über die Nutzung der natürlichen Ressourcen der Nation zu beteiligen. Diese Vorstellung von Demokratie ist ein Bollwerk gegen den Prozess der Privatisierung von Infrastruktur, sie schiebt auch der geplanten Privatisierung des Erdöls einen Riegel vor.“ Die mexikanische Regierung stellt das neue Gesetz dagegen als großen Erfolg dar. Der Abgeordnete Samuel Yocelevitz Fraustro von der rechtsliberalen Regierungspartei PAN macht deutlich, von welchem Geist die Indígena-Politik der Regierung getragen ist: „Das Territorium gehört allen Mexikanern und da können wir niemanden bevorzugen. Aber die indígenas haben jetzt alle erdenkliche Autonomie für ihre Sitten und Gebräuche und alles, was sie wollen. Und sie haben das Recht, das Land zu bebauen. Wir wollen ja, dass der Indianer produktiv ist. Denn er ist ja tatsächlich fleißig. Doch er hat Probleme damit, Profit zu machen, weil er in abgelegenen Tälern lebt. Man muss ihnen also nicht nur beibringen, wie sie Erträge aus der Erde holen, sondern auch, wie sie diese Erträge kommerzialisieren können." Angesichts derartiger, jahrhundertealter Überheblichkeit haben die Zapatisten, die in Mexiko nur der sichtbarste Ausdruck der breiten indianischen Protestbewegung sind, alle Kontakte mit der Regierung abgebrochen. Das verabschiedete Gesetz hat nicht nur den Widerstand aller indianischen Organisationen des Landes hervorgerufen, sondern sogar einiger Gouverneure. 300 Klagen wurden bisher vor dem Verfassungsgericht eingereicht. Unterdessen bleibt der Friedensprozess mit der EZLN in Chiapas weiter ausgesetzt.
Verarmung in reichen Regionen
Doch zeigen verschiedene Beispiele, dass selbst wenn einmal gesetzliche Regelungen erkämpft sind, die den Indiogemeinschaften tatsächliche und materielle Selbstbestimmung garantieren, damit noch lange nicht das Ende der Konflikte erreicht ist. So will der venezolanische Präsident Chávez trotz der von ihm forcierten Selbstbestimmungsregelung und gegen den Widerstand der Pemones an seinem Hochspannungs- Megaprojekt mit Brasilien festhalten. Papier ist bekanntlich geduldig, und die meisten lateinamerikanischen Staaten haben Justizsysteme, in denen Bürger ohne großes gesellschaftliches Prestige ihre Rechte gegen den Staat nur schwerlich einklagen können.
In Kolumbien befinden sich die U’wa-Indianer seit 1999 im Konflikt mit der Regierung und dem US-Ölkonzern Occidental Petroleum, der auf ihrem angestammten Gebiet Erdöl fördern will. Die derzeit stattfindenden Probebohrungen wurden mittels massiver Militärpräsenz gegen den Widerstand der U’wa durchgesetzt, obwohl diese erklärten, Ölförderung sei mit ihren religiösen und kulturellen Beziehungen zur Natur und zur Erde absolut nicht zu vereinbaren, und mit kollektivem Selbstmord drohten.
Auch in Nikaragua kümmerte sich, nachdem Sandinistenführer Daniel Ortega bei den Präsidentschaftswahlen 1990 gegen die Konservativen unterlegen war, kaum noch jemand um Verfassung und Autonomie. „Die Regierung will die Atlantikküste wie eine Kolonie halten, die sie ausbeuten können“, versicherte vor einiger Zeit Hugo Sujo, Direktor der Stiftung für Autonomie und Entwicklung an der Atlantikküste Nikaraguas. „Sie überreicht Konzessionen für das Minenwesen und den Fischfang an ausländische Unternehmen, aber die hier lebenden Menschen verarmen immer mehr, obwohl wir in einer der reichsten Regionen Nikaraguas leben“, berichtete er weiter. Sujo warnte: „Wenn die Bedingungen an der Küste sich nicht ändern, wird es wie in den 80er Jahren gewalttätige Auseinandersetzungen geben.“ Insofern hat der NIC mit seiner Einschätzung vielleicht Recht: Im Verlauf der Auseinandersetzungen der letzten Jahre haben die lateinamerikanischen Ureinwohner ein geschärftes Bewusstsein von ihrer Würde und ihren Rechten erlangt, und sie scheinen entschlossen, alle Mittel einzusetzen, um diese auch in der Praxis durchzusetzen.