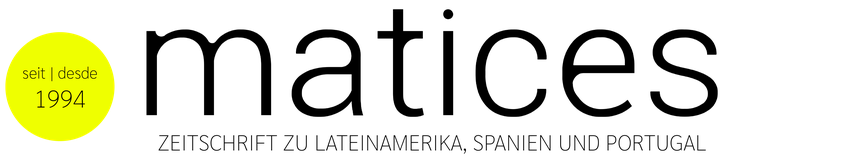Kampf um Überleben und Identität
Indigene Völker in Kolumbien
von Theodor Rathgeber
Indigene Völker kämpfen in Kolumbien nicht erst in jüngerer Zeit um ihr physisches und kulturelles Überleben. Seit der spanischen Konquista sehen sie sich einer zuweilen existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Mit Fortsetzung in die Gegenwart: Seit 1971 kosteten die Auseinandersetzungen um Landrechte allein im Departement Cauca annähernd 500 führenden Persönlichkeiten der Ureinwohner das Leben. Damals wie heute geht es vor allem um Landrechte, die Legalisierung traditioneller Territorien und die Eigentumsübertragung wieder besetzter Ländereien. Ebenso müssen indigene Gemeinschaften immer wieder Projekte abwehren, die den Zugriff auf Bodenschätze und Naturressourcen erzwingen wollen, die auf ihren Ländereien vorkommen.
Diese Konflikte haben im Zuge der Ökonomisierung aller Lebensbereiche zugenommen. Ungehinderte Kapitaltransfers zur Investition in entfernteste Gebiete, die Ausbeutung von Naturressourcen an fast jedem Ort und jederzeit, machen auch vor entlegenen indigenen Dorfgemeinschaften nicht Halt. Erdölförderung, der Abbau von Gold und Kohle, das Einschlagen von Holz, die Gewinnung elektrischer Energie durch Wasserkraftwerke, die Erschließung biologischer und pflanzengenetischer Ressourcen oder der Bau von Kanälen, Schnellstraßen und militärischen Anlagen führen zu schwersten Beeinträchtigungen des physischen und kulturellen Überlebens indigener Gemeinschaften. Seit den 1980er Jahren hat sich die Regierungspolitik dem Modell der Marktöffnung verschrieben; d.h. der Liberalisierung des Handels, dem Schutz ausländischer Investitionen zur Ausbeutung von Bodenschätzen und der Anpassung der innerstaatlichen Gesetze etwa für die Bereiche Bergbau und Erdölförderung. Rechtliche Vorgaben zum Schutz der Umwelt und zur Vergabe der Lizenzen wurden zuungunsten der Ureinwohner abgebaut, damit solche Vorhaben auch in ökologisch sensiblen Gebieten durchgeführt werden können.
So legten die Minister für Bergbau, Energie und Transport im Jahr 1999 ein Gesetz vor, demzufolge keine Umweltlizenzen mehr nötig sein sollten, um die Exploration und Förderung im Bereich von Erdöl und Bergbau zu genehmigen. Bei Großprojekten sollte die Konsultation der betroffenen Gemeinschaften und die Vergabe der Umweltlizenz auf die Form eines einfachen Verwaltungsverfahren zurückgestuft werden.
Hätte eine Gemeinschaft an einem von der Verwaltung einberufenen Konsultationstreffen nicht teilnehmen und ihre Einwendungen nicht vorbringen können, hätte dies zukünftig im Verfahren zur Freigabe des Vorhabens nicht weiter berücksichtigt werden müssen. Wer sich nur ein wenig mit den Konflikten um den Ressourcenabbau auf indigenen Territorien und gerade dem Problem der Kommunikation zwischen den Parteien beschäftigt hat, weiß, dass diese Regelungen schlicht auf den faktischen Wegfall der Einspruchsmöglichkeit hinausgelaufen wäre.
Nationaler und internationaler Protest konnten zwar das Schlimmste dieses Gesetzesentwurfes verhindern, aber die beabsichtigte Straffung des Verfahrens wurde von der Regierung durchgesetzt. So wird es in Zukunft nur noch eine einzige Lizenz für den gesamten Projektablauf geben.
Mit den heute geltenden Vorschriften wären etwa die U’wa völlig unter die Räder gekommen. Die rund 5.000 Angehörigen der U’wa leben im Nordosten Kolumbiens an der Grenze zu Venezuela. In dieser Region wurde seit 1994 die Exploration und Ausbeutung von Erdöl auf 380.000 Hektar vorangetrieben. Auch die Firma Occidental de Colombia Inc., ein Tochterunternehmen der US-Gesellschaft Occidental Petroleum Corp., wollte auf dem Territorium der U’wa ebenfalls nach Erdöl suchen. Die indígenas lehnen eine Erdölförderung kategorisch ab, da sie nicht nur schwerwiegende ökologische Zerstörungen befürchten, sondern ihre Kultur, Spiritualität und Lebensweise grundsätzlich in Frage gestellt sehen. Vor Augen haben sie die Zerstörung der Umwelt und schleichende Vernichtung bei den Yaraki (bei Barrancabermeja) in den 1920er Jahren und den Guajibos in Caño Limón, einem Gebiet mit Kohletagebau und Erdölvon förderung. Prostitution, Drogen- und Alkoholexzesse sowie die Operationen verschiedener bewaffneter Akteure brachten das Leben der indigenen Gemeinschaften nahezu zum Erliegen. Aufgrund der damals geltenden Rechtsvorschriften erzwangen die U’wa mit Hilfe mehrerer Gerichtsentscheidungen einige Konsultationstreffen, um insbesondere ihre Vorbehalte und Einwendungen den Betreibern verdeutlichen zu können. Nach jahrelangen Kämpfen, Demonstrationen, Straßensperren und gerichtlichen Auseinandersetzungen hatte Occidental de Colombia letztlich zwar freie Hand erhalten, stellte die weitere Exploration jedoch im Jahr 2001 ein, nachdem die ersten Ergebnisse über vermutete Ölquellen sich als unergiebig herausgestellt hatten.
Militärische Zuspitzung
Die paramilitärischen Banden (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) wuchsen in den letzten 15 Jahren auf über 350 Gruppen an. Sie griffen mehrfach Ureinwohner an und verübten Massaker. In manchen Gebieten vermengen sich darüber hinaus die Interessen der Paramilitärs mit denen der Drogenmafia. Ebenso wie die Paramilitärs setzen aber auch die Guerrilleros der FARC indigene Gemeinschaften unter Druck, Lebensmittel und junge Kämpfer zur Verfügung zu stellen. Der Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) oder die Organización Indígena de Antioquia (OIA) haben in den vergangenen Jahren mehrfach erfolglos an die FARC appelliert, die Autonomierechte der indigenen Gemeinschaften zu respektieren.
Die einzige Antwort staatlicher Sicherheitsorgane auf bewaffnete Kämpfe in den Regionen ist die Militarisierung. Seit der Ratifizierung des Ley de Seguridad y Defensa Nacional (Gesetz über nationale Sicherheit und Verteidigung, August 2001) steht ein legales Instrument zur Verfügung, um auf Gemeinde- und Departementsebene die politische Macht den jeweiligen Militärkommandanten zu übergeben; also auch Gouverneure zu entmachten. Diese Übertragung weit reichender Vollmachten an die Armee wurde im April 2002 zwar durch das Verfassungsgericht außer Vollzug gesetzt, aber schon im Februar des gleichen Jahres - im Kontext des Scheiterns der Friedensgespräche - hatte Präsident Pastrana ein auf diesem Gesetz beruhendes Dekret erlassen. Armeeangehörigen wurden sogar noch Kompetenzen der Judikative an die Hand gegeben:
gerichtsverwertbare Untersuchungen vorzunehmen, Anklageschriften zu verfassen und Verdächtige ohne Haftbefehl festzuhalten.
Für indigene Gemeinschaften hat die Militarisierung gravierende Folgen. Sie macht einen normalen Ablauf des Alltags unmöglich, unterbindet den traditionellen Austausch von lebenswichtigen Nahrungsmitteln und Medikamenten für Weiler und Gehöfte in verschiedenen Klimazonen und beschneidet die Bewegungsfreiheit zur Ausübung traditioneller Zeremonien. Versammlungen der Dorfgemeinschaften werden verboten, die traditionellen Formen der Selbstorganisation unterbunden oder gar zerstört, nicht genehme politische Äußerungen unterdrückt. Nicht umsonst weisen indigene Organisationen insbesondere in den Regionen Cauca, Chocó, Antioquia und Córdoba ihre Entwicklungspläne in jüngerer Zeit als ‚Planes de Vida‘ aus. Der Name umschreibt sowohl die tödliche Bedrohung durch private und staatliche Entwicklungspläne, als auch die akute Lebensgefahr für die handelnden Personen, wenn sie den Vorgaben der bewaffneten Akteure eine Absage erteilen.
Militarisiert werden nicht zuletzt alle Regionen, in denen in größeren Mengen illegale Pflanzungen für die Drogenherstellung angebaut werden.
Die Drogenbekämpfung der Regierung Pastrana konzentrierte sich auf das Besprühen der Anbauflächen aus der Luft. Die Notwendigkeit, auch ordnungspolitisch gegen die Drogenwirtschaft vorzugehen, soll nicht bestritten werden. Nur hat sich die Vorstellung als Illusion erwiesen, die Vernichtung der Koka- und Schlafmohnfelder durch das Besprühen aus der Luft hätte bleibende Ergebnisse im Sinne der Drogenbekämpfung gebracht.
Geblieben sind ökologische Schäden, Flüchtlinge, Korruption und destabilisierte rechtsstaatliche Institutionen. Dagegen stiegen die Hektarzahlen für den Koka-Anbau von 54.000 Hektar 1995 trotz oder gerade wegen großflächiger Entlaubungseinsätze aus der Luft auf ca. 120.000 Hektar im Jahr 2000. Militärisches Vorgehen verlagert die Anbauflächen in andere Zonen; mittlerweile in den Regenwald. Mit dem Besprühen einher geht eine Verknappung des Nahrungsangebots, da die Flugzeuge entgegen den Vorschriften zu hoch fliegen, um nicht abgeschossen zu werden. So verteilt sich das Entlaubungsmittel auch auf angrenzende Äcker, auf denen Grundnahrungsmittel gezogen oder Haustiere gehalten werden.
Als Alternative zum Drogenanbau bietet der Staat den kleinbäuerlichen – auch den indigenen – Produzenten den Anbau von Ölpalmen, Naturkautschuk oder Kakao sowie die Verwertung von Nutzhölzern oder Viehzucht an. Das macht aus Sicht der Produzenten jedoch wenig Sinn, denn diese Option hatten sie auch früher schon. Sie haben sie jedoch nicht wahrgenommen, weil ihnen die Vermarktungsmöglichkeiten fehlten und die Rendite für den Drogenanbau um ein Mehrfaches höher liegt. Demgegenüber boten indigene Gemeinschaften zusammen mit dem CRIC schon im Jahr 1991 der damaligen Regierung von Präsident Gaviria eine schrittweise Verminderung des Mohnanbaus an; unter der Regie der Gemeinden, ohne Militarisierung und ohne den Einsatz chemischer Entlaubungsmittel aus der Luft. Sie erreichten damals den Rückbau von 5.000 Hektar Mohnanbaugebiet. Das zur finanziellen Stützung alternativer Kulturen vorgesehene Regierungsprogramm stellte jedoch nur fünf Prozent des ausgehandelten Budgets zur Verfügung. Von 23 Projekten begannen überhaupt nur elf, und diese blieben auf halbem Wege stecken, weil die finanziellen Mittel und die zugesagte technische Beratung durch staatliche Einrichtungen ausblieben. Die Beteiligten an diesen Reduktionsmaßnahmen gingen zudem ein hohes Risiko ein; Drohungen und Morde sind an der Tagesordnung. Gleichwohl haben die im Cauca organisierten Ureinwohner immer wieder selbst die Initiative gegen den Anbau von illegalen Pflanzungen ergriffen. Sie mussten erkennen, dass die Drogenökonomie zusammen mit der einbrechenden Gewaltförmigkeit der Konflikte ihre Gemeinschaften ebenso zersetzt wie andere von außen aufgezwungene Projekte. So haben z.B. die Nasas (Páeces) in Jambaló (Tierradentro, Cauca) im Juni 2000 acht Laboratorien und im Juni 2001 mehrere Anbaukulturen zerstört. Teile des Konzepts dieser Selbstinitiativen sind seit der Wahl des indigenen Gouverneurs Tunubalá im Cauca auch in dessen Regierungsprogramm ”Plan Alterno“ eingeflossen.
Alternativen
Dass indigene Völker und Gemeinschaften in Kolumbien alternative Optionen bereit halten, ist wesentlich dem seit Ende der 1960er Jahre einsetzenden Organisationsprozess geschuldet. Im Jahr 1971 wurde der CRIC gegründet, der sich aus der damals radikalisierten Landreformbewegung heraus entwickelte. Aus den ursprünglich kleinbäuerlich orientierten Landrechtskonflikten entwickelte sich bei den Ureinwohnern jedoch innerhalb weniger Jahre ein umfassender Politikansatz zur Rückgewinnung der kulturellen Wurzeln, von Identität und politischer Autonomie. So änderte der CRIC bereits nach zwei Jahren seine Organisationsstruktur und bezog fortan die Gemeinschaft und ihre politischen wie spirituellen Repräsentanten systematisch in alle Entscheidungen mit ein. Dieser Organisationsprozess im Cauca war Vorbild für viele andere Regionen. So existieren heute 36 regionale Dachorganisationen. Zur besseren Koordination der regionalen Dachverbände wurde 1982 die nationale Dachorganisation Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) gegründet, die heute ca. 90 Prozent der Ureinwohner repräsentiert. Daneben gibt es die Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) als Vertretung der indigenen Völker aus dem Amazonasgebiet. In den letzten 30 Jahren konnte die indigene Bewegung in Kolumbien ca. 28 Mio. Hektar Land vor allem im Einzugsgebiet des Amazonas zurückerobern und mit Rechtstiteln ausstatten. Nicht weniger wichtig waren die in der neuen Verfassung von 1991 erzielten Rechte.
Im Bereich der öffentlichen Meinungsbildung gibt es zur Zeit nur noch wenige Flecken auf kolumbianischem Staatsgebiet, auf denen Versammlungen abgehalten, offene Debatten geführt und politische Meinungsunterschiede mit zivilen Mitteln ausgetragen werden können.
Schon die Reise zu solchen Veranstaltungen oder Treffen ist risikoreich, teilweise lebensgefährlich geworden. Einer dieser wenigen Flecken befindet sich am Ort La María/Piendamó im Departement Cauca. Betitelt als ”Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación“ haben die Ureinwohner von Cauca an der Panamericana ein resguardo als Raum für Debatten der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt. Hier sollen all jene zu Wort kommen, die im bipolaren Freund- Feind-Denken normalerweise auf der Strecke bleiben. Seit 1999 diente La María/ Piendamó als Konferenzort, der sich als Alternative zu den Dialogen zwischen Regierung und FARC-Guerrilla verstand. Von beiden Parteien fühlten sich weder Ureinwohner noch andere soziale Bewegungen vertreten.
Die Sorge um die Zukunft der indigenen Völker in Kolumbien ist begründet. Die Verfassungsgarantie auf eine autonome Existenz und Landrechte, auf die ungehinderte Praktizierung der eigenen Religion, Sprache oder kulturellen Traditionen ohne Angst vor Diskriminierung oder gar Verfolgung wird aktuell von der Realität ad absurdum geführt. Angesichts dieser Realität, in der das Recht des Stärkeren zum Maß der Dinge geworden ist, benötigen sie mehr denn je die Unterstützung durch internationale Solidarität, die auf die Gefahr für das physische und kulturelle Überleben hinweist und immer wieder rechtsstaatliche Institutionen, dialogische Konfliktlösungen sowie den Respekt vor kulturellen Leitbildern anderer einfordert. Es wäre ein nachhaltiger Beitrag zum Überleben indigener Völker - nicht nur in Kolumbien.