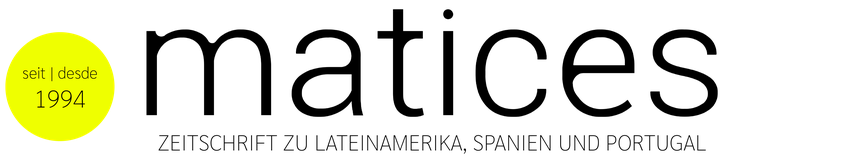Neoliberalismus oder was?
Neoliberalismus und soziale Gerechtigkeit in Lateinamerika
von Andreas Boeckh
Wer „Neoliberalismus“ mit „capitalismo salvaje“ übersetzt, und dies tut man gern in Lateinamerika, für den sind „Neoliberalismus“ und „soziale Gerechtigkeit“ Gegensatzpaare. Mit „Neoliberalismus“ werden „soziale Kälte“, Ellenbogengesellschaft“ bzw. „Zweidrittelgesellschaft“ assoziiert, aber bestimmt nicht „soziale Gerechtigkeit“. Mehr noch: Nach gängiger Lesart verschärft der Neoliberalismus soziale Polarisierungsprozesse und trägt somit zur sozialen Ungerechtigkeit bei. Gerade die Transformationen in Lateinamerika scheinen als Experimentierfeld für neoliberale Anpassungspolitiken der schlagende Beweis für dieses Argument zu sein, sind doch die sozialen Resultate der neuen Wirtschaftspolitik alles andere als überzeugend, und steht die Begleichung der viel beschworenen „sozialen Schuld“ nach wie vor aus.
Diese Schelte trägt aber wenig dazu bei, die Entwicklungsprobleme und die Problematik der sozialen Gerechtigkeit in Lateinamerika wirklich zu verstehen, und dies gleich aus einer Reihe von Gründen: Erstens wird nie wirklich geklärt, was mit „Neoliberalismus“ gemeint ist.
„Neoliberalismus“ ist ein Kampfbegriff derer, die ihn kritisieren. Es gibt aber kaum jemanden, der ihn für sich in Anspruch nimmt. Oft wird er als Synonym für die Durchsetzung der volkswirtschaftlichen Marktsteuerung gebraucht. Bei der Durchsicht der neueren deutschen und lateinamerikanischen Literatur zum Thema „Neoliberalismus“ ist dies in der Tat die vorherrschende Tendenz. Eine Marktwirtschaft kann jedoch viele Gesichter haben, einigermaßen soziale und weniger soziale. Falls mit „Neoliberalismus“ tatsächlich „Marktwirtschaft“ gemeint ist, dann muss man zweitens darauf verweisen, dass das alte Entwicklungsmodell der Staatssteuerung und der Binnenorientierung nicht gerade an seinem Erfolg zugrunde gegangen ist. Wer also den Übergang zu einer stärkeren Marktsteuerung ökonomischer und gesellschaftlicher Allokationsprozesse für das eigentliche Übel hält, müsste den Nachweis führen, dass entweder das alte Modell hätte stabilisiert, oder aber in ein anderes überführt werden können, das bessere soziale Resultate hervorgebracht hätte. Drittens wird unterstellt, dass alle Länder Lateinamerikas weitgehend identischen und als „neoliberal“ zu charakterisierenden Reformen unterzogen worden sind. Die Richtung, in die sich die Transformationen bewegen, ist zwar die selbe, doch sind die Modalitäten und Tempi keineswegs identisch. Gerade im Hinblick auf die sozialen Komponenten der Transformationsstrategien gibt es erhebliche Varianzen. Es bliebe zu klären, welchen der Transformationpfade man als „neoliberal“ zu bezeichnen wünscht. Viertens fällt auf, dass der Neoliberalismus und seine Folgen gerade in solchen Ländern besonders heftig beklagt werden, die sich noch am wenigsten und wenn, dann nur sehr langsam und vorsichtig, auf Marktreformen eingelassen haben(Ekuador, Venezuela aber auch Brasilien). Dies weckt den Verdacht, dass sich der Widerstand der alten Entwicklungskoalitionen und der Gruppen, die man heute als „rent-seekers“ bezeichnet, u.a. als Kritik am „Neoliberalismus“ äußert. Wenn etwa in Brasilien die Bezieher von üppigen Mehrfachrenten die überaus mühsamen und zaghaften Rentenreformversuche der Regierung als neoliberal und antisozial kritisieren, darf man durchaus Zweifel hegen.
Will man nicht Polemiken folgen und interessenbezogenen Standpunkten auf den Leim gehen, muss man den Zusammenhang zwischen Neoliberalismus und sozialer Gerechtigkeit in einer Weise untersuchen, dass das Ergebnis nicht schon von vornherein feststeht. Zunächst einmal muss geklärt werden, was wir unter „Neoliberalismus“ verstehen wollen, und worin dieser sich von anderen Arten der Marktsteuerung unterscheidet.
Zum Kern neoliberalen Gedankenguts gehört der Glaube an die umfassende Steuerungsfähigkeit des Marktes. Je schneller der Übergang zur Marktwirtschaft bewerkstelligt wird, und je weniger der Staat in diesem Prozess interveniert, desto besser für alle Beteiligten.
Wirtschaftswachstum, Konkurrenzfähigkeit und mittelfristig auch Wohlfahrtsgewinne, die allen zugute kommen, lassen sich nach neoliberalem Credo am besten durch das freie Spiel der Marktkräfte erzielen. Auf dem Hintergrund staatsinter-ventionistischer Erfahrungen in Lateinamerika ist daher das zentrale Thema der Rückzug des Staates als Unternehmer und als ökonomische Steuerungsinstanz. Im sog. „Washington Konsens“ geht es vor allem um diesen Rückzug, d.h. es wird hervorgehoben, was der Staat alles nicht tun soll und was er alles dem Markt überlassen soll. Insofern kann dieser Konsens als Quintessenz neoliberaler Politikempfehlungen gelten, wenngleich dort nirgendwo steht, dass die Transformationen schlagartig zu erfolgen hätten, und wenngleich der Konsens auch Elemente enthält, die man normalerweise nicht mit „Neoliberalismus“ assoziieren würde. Zusätzlich zu der eher negativen Bestimmung der Staatsaufgaben in dem Konsens kommen nach liberaler Auffassung dem Staat die Aufgaben zu, den ordnungspolitischen Rahmen abzusichern, für Berechenbarkeit und Regelverlässlichkeit zu sorgen und bestimmte öffentliche Güter bereitzustellen.
Allerdings wird der Bereich, in dem der Staat öffentliche Güter zur Verfügung stellen soll, inzwischen immer enger gefasst. Ferner hat er sozialpolitisch diejenigen Mitglieder abzusichern, die im Transformationsprozess sonst zugrunde gehen würden, und die auch in einer funktionierenden Marktwirtschaft nicht für sich sorgen können. Hohe Sozialleistungen sind nach liberalem Credo nur in der Phase des Übergangs zu erwarten. Funktioniert der Markt, gibt es nur noch wenige Mitglieder der Gesellschaft, die staatlicher Hilfe bedürfen. Die Sozialpolitik sollte sich auf punktgenaue, assistenzialistische Maßnahmen beschränken, welche nur den wirklich Bedürftigen zugute kommen. Dies wird mit dem Begriff der Zielgruppenorientierung der Sozialpolitik umschrieben. Eine soziale Grundversorgung und Konsumsubventionen, wie sie früher üblich waren, werden abgelehnt. Dies impliziert auch die Privatisierung der sozialen Sicherungen (Krankenkassen und Rentenversicherungen). Auch hier kommt der Staat nur noch für diejenigen auf, die sich eine private Absicherung nicht leisten können.
Der „Washington Konsens“ wurde spätestens mit dem Weltentwicklungsbericht der Weltbank von 1997 aufgekündigt, der stark der „Neuen Institutionellen Ökonomie“ verpflichtet ist. Auch im Jahresbericht 2000 der Interamerikanischen Entwicklungsbank ist fast nur noch vom Staat und den entwicklungsförderlichen Staatsaufgaben die Rede, die der Staat in Lateinamerika zu erbringen hätte, aber nicht erbringt. Dies bedeutet jedoch, dass in und für Lateinamerika heute kaum noch neoliberale Konzepte in ihrer reinen Form vertreten werden, und dass die neoliberale Phase selbst auf der Ebene der konzeptionellen Diskussion nicht lange angedauert hat. Nun kann man diese Kontroversen im Kontext von marktwirtschaftlichen Diskursen für ein belangloses Gerangel im Käfig halten, da es allemal um Marktwirtschaft gehe. Dann allerdings wäre die Frage nach funktionsfähigen Alternativen jenseits der Marktwirtschaft zu stellen.
Der eingangs geäußerte Verdacht, dass die Transformationen zur Marktökonomie in Lateinamerika nicht überall und vermutlich sogar in der geringeren Zahl der Fälle nach neoliberalem Muster erfolgt ist, lässt sich nun erhärten: Am ehesten entsprechen die von der chilenischen Militärdiktatur im Jahre 1975 durchgesetzte Marktöffnung und Sozialpolitik neoliberalen Konzepten: Sie erfolgte rasch, umfassend, sie führte zum Verschwinden von ganzen Branchen, zu hoher Arbeitslosigkeit und zu einem explosionsartigen Anstieg der Armut, die durch staatliche, rein assistenzialistisch angelegte Sozial- und Arbeitsbeschaffungsprogramme abgefedert wurde. Es wurden für die Bevölkerung starke Anreize geschaffen, um von staatlichen zu privaten Systemen der sozialen Sicherung überzuwechseln. Banken und Staatsbetriebe wurden privatisiert, allerdings mit Ausnahme des Kupfersektors. Andere Länder, die sich, wenn auch nicht mit der selben Radikalität wie Chile, auf neoliberale Anpassungsstrategien eingelassen haben, sind Argentinien (nach 1991), Bolivien (nach 1985) und Peru (ebenfalls nach 1991). Die mexikanischen Transformationen waren zwar ebenfalls recht radikal, verbanden sich aber mit Kompensationsprogrammen, die weit über das hinausgingen, was eine neoliberale Strategie zulassen würde. Kolumbien nimmt bzgl. der Wirtschaftsliberalisierung und der Privatisierung der sozialen Sicherungssysteme eine mittlere Position ein, in Venezuela ist ein neoliberaler Ansatz nach kurzer Zeit gescheitert, und das größte und wichtigste Land des Subkontinents, nämlich Brasilien, hat erst spät und dann sehr zögerlich mit Marktreformen begonnen, die aber beim besten Willen nicht als „neoliberal“ charakterisiert werden können. Alles in allem ist die Bilanz keineswegs einheitlich, Und man muss sich daher davor hüten, die insgesamt sehr bescheidenen sozialen Resultate der ökonomischen Transformationen in Lateinamerika komplett auf das Konto des Neoliberalismus zu verbuchen.
Armut und Einkommensverteilung
Nicht nur die Einkommensniveaus sind in Lateinamerika sehr bescheiden, die Einkommen sind zudem noch ungerechter verteilt als in jeder anderen Region der Welt. Wäre die Einkommensverteilung in Lateinamerika mit der in Ostasien vergleichbar, würde sich die Zahl der in Armut lebenden Personen in Lateinamerika halbieren. Ausgerechnet das industriell am weitesten entwickelte Land des Subkontinents, nämlich Brasilien, hat nach Gabun die schlechteste Einkommensverteilung der Welt aufzuweisen, und der Präsident dieses Landes hat den bemerkenswerten Satz formuliert, Brasilien sei kein unterentwickeltes, sondern ein ungerechtes Land.
Betrachtet man diese Graphik, dann wird deutlich, dass sich in einer Reihe von Ländern, aber nicht überall die Einkommensverteilung verschlechtert hat. Ordnet man die Veränderungen dem Typ der Anpassungspolitik zu (mehr oder weniger neoliberal), ergibt sich kein deutliches Bild. In Ländern mit einem neoliberalen Transformationsprofil (Chile und Argentinien) hat sich die Einkommensverteilung ebenso verschlechtert wie in Ländern, die anderen Strategien gefolgt sind (Brasilien, Venezuela). In Bolivien, das einen radikalen Anpassungskurs gefahren ist, hat sie sich verbessert, aber auch in Uruguay, das eine sehr viel vorsichtigere Politik betrieben hat. Schauen wir uns nun die Armutsentwicklung der letzten Jahrzehnte an. Die hier zunächst präsentierten Zahlen beziehen sich auf einen Zeitraum, der nach dem Ausbruch der Schuldenkrise liegt, aber noch vor der Ablösung heterodoxer durch mehr orthodoxe bzw. neoliberale Anpassungsmaßnahmen.
Es zeigt sich, dass die heterodoxen Versuche der Krisenbewältigung vor den 90er Jahren keineswegs in der Lage waren, eine Zunahme der Armut zu verhindern. Ganz anders das Bild für die 90er Jahre. Mit der Ausnahme von Venezuela und Honduras hat sich der Anteil der in Städten lebenden Armen z.T. geringfügig, z.T. aber auch beträchtlich verringert.
Markttransformationen und Sozialpolitik
Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit erfordert wenigstens eine skizzenhafte Auseinandersetzung mit der Sozialpolitik in Lateinamerika. Inwieweit war und ist sie in der Lage, die soziale Polarisierung und die eklatanten Einkommensunterschiede wenigstens ansatzweise zu korrigieren, und inwieweit ist sie selbst Teil des Paradigmenwechsels der 90er Jahre?
Auch hier wollen wir uns zunächst einmal einen groben Überblick über die Entwicklung der Sozialausgaben in der letzten Zeit verschaffen.
Die Graphik macht deutlich, dass im Zusammenhang mit der Schuldenkrise die Sozialausgaben z.T. drastisch zurückgegangen sind, dass sie dann aber zu Beginn der 90er Jahre wieder angestiegen sind, und zwar in fünf von 12 Ländern über das Niveau von 1980 hinaus. Dies ist allenfalls eine Trendaussage. Um die Zahlen präzise beurteilen zu können, müsste man sie herunter brechen: Nicht alles, was hier als Sozialausgabe verbucht wird, verdient diesen Namen. Gleichwohl lassen diese Zahlen nicht den Schluss zu, dass die Entwicklung der Sozialleistungen grundsätzlich als Anpassung auf Kosten der Armen bezeichnet werden könne.
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die staatlichen Sozialausgaben vor der Krise oft am wenigsten denjenigen zugute gekommen sind, die sie am meisten benötigten. Unter dem Strich beeinflussten die Erziehungs- und Sozialausgaben in fast allen Ländern der Region die Einkommensverteilung regressiv, da die armen Bevölkerungsschichten mehr zur ihrer Finanzierung beitrugen als sie aus ihnen Nutzen ziehen konnten. Die staatlichen Investitionen im Bildungs- und Gesundheitsbereich bevorzugten vor allem die Mittelschichten, und spezielle Programme wie der Wohnungsbau liefen oft trotz einer ganz anderen Zielsetzung ebenfalls auf eine Einkommenssubvention vor allem der Mittelschichten hinaus. „Statt zu einer größeren sozialen Verteilungsgerechtigkeit beizutragen, reproduziert das staatliche soziale Sicherungssystem die extrem ungleiche Sozialstruktur und strukturelle Heterogenität der lateinamerikanischen Gesellschaften“ (Karin Stahl).
Vor allem infolge des zunehmenden Einflusses von Interessengruppen auf die Ausgestaltung der sozialen Sicherung ist gerade in den Ländern, die früh mit der Einführung sozialer Sicherungssysteme begonnen haben, ein hochgradig segmentiertes System mit einer Vielzahl von institutionell verankerten Sonderregelungen und Privilegien entstanden, dessen Fragmentierung die der frühen europäischen Sozialsysteme noch bei weitem übertroffen hat, und das oft mehr vertikal (über eine Erhöhung der Leistung für Versicherte) als horizontal (über eine Erhöhung der Zahl der Versicherten) expandierte. In Kolumbien wurden zu Beginn der 90er Jahre ca. 1000 Institutionen im Bereich der sozialen Sicherung gezählt, die ihre spezielle Klientel bedienten. Anderswo sind die Verhältnisse offenbar nicht so extrem, wenngleich auch dort lange Zeit bei den Leistungsprofilen der Sozialversicherung starke Disparitäten zu beobachten waren. Die Höhe der Sozialausgaben stand in Lateinamerika selten in einem vertretbaren Verhältnis zu den von ihnen erzielten Resultaten. Dort, wo Reformen bei den Kranken- und Pensionskassen unternommen wurden, folgten sie in der Regel dem chilenische Vorbild, wenngleich es hinsichtlich der Radikalität der Umstellung nach wie vor deutliche Unterschiede gibt: Die Tendenz geht in Richtung Privatisierung bei den Pensionskassen und im geringeren Maße auch bei der Krankenversicherung.
Wenn staatliche Sozialausgaben und Konsumsubventionen gekürzt werden, muss dies gar nicht so sehr die wirklich Armen berühren und tut dies oft auch nicht, zumal wenn sie mit einer zielgruppenorientierten Fokussierung der Sozialausgaben einher geht, wie dies in Lateinamerika zunehmend der Fall ist. Wo die neuen Programme funktionieren, werden jetzt überhaupt zum ersten Mal auch solche Gruppen in der Gesellschaft erreicht, die bislang vom Staat nichts zu erwarten hatten, so etwa bei dem viel gerühmten und als vorbildlich eingeschätzten Fondo de Emergencia Social in Bolivien. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass in einigen Ländern mit den zielorientierten Programmen neue Klientelstrukturen geschaffen werden, und dass mit ihnen politische Legitimation für den Transformationsprozess erkauft wird. Insbesondere das mexikanische Programm Pronasol stand in diesem Verdacht. Die Chancen, auch bei einem geringeren Volumen der Sozialausgaben deren Effizienz durch eine bessere Fokussierung zu verbessern, sind z.T. verspielt worden, da auch die „neue“ Sozialpolitik alten Regeln folgt, d.h. doch wieder klientelistischen Kriterien unterliegt. Trotz der stärkeren Zielgruppenorientierung hat sich nach neueren Zahlen der CEPAL der regressive Effekt vieler Sozialausgaben in wichtigen Ländern des Subkontinents immer noch nicht eliminieren lassen. In anderen Worten: Von einigen Ausnahmen abgesehen, hat die Sozialpolitik zum Abbau von sozialer Ungerechtigkeit wenig bis gar nichts beigetragen.
Die sozialen Folgen der externen Verletzlichkeit
Die statistischen Befunde künden ganz offensichtlich nicht von sozialen Verwüstungen im Zuge der Marktreformen. Gleichwohl ist die Situation alles andere als befriedigend. Detlef Nolte hat dies kürzlich zu der Feststellung veranlasst, „dass die Mehrheit der Lateinamerikaner in der sogenannten „Dekade der Hoffnung“ über das Hoffen nicht hinausgekommen ist“. Damit sind die enttäuschenden Wachstumsraten der 90er Jahre angesprochen. Sie Übertrafen zwar mit durchschnittlich 3,2 Prozent (1990-1998) die der 80er Jahre, aber sie liegen deutlich unter dem Niveau der Importsubstitutionsphase in den 50er bis 70er Jahren (5,5 Prozent). Wenn man die Verringerung der Armut allein vom Wirtschaftswachstum erhofft, dann waren sie nicht hinreichend, um die Armut in Lateinamerika signifikant zu reduzieren.
Die Verletzlichkeit Lateinamerikas gegen externe Schocks ist nach wie vor sehr hoch. Jedes Land ist in den 90er Jahren mindestens einmal von einem solchen Schock betroffen worden, was mit z.T. erheblichen Wohlfahrtsverlusten verbunden war. Der sog. Tequila-Schock führte 1994 in Mexiko zu einer Abwertung des Peso um 71 Prozent und zu beträchtlichen Einkommensverlusten. Argentinien konnte damals seinen währungspolitischen Stabilitätsanker nur um den Preis einer brutalen Austeritätspolitik bewahren, die dem Land zeitweise eine Arbeitslosigkeit von knapp 20 Prozent bescherte. Die Russland- und Asienkrise hat nicht, wie es sich manche in Lateinamerika erhofft hatten, Lateinamerika als Hort der Stabilität erscheinen lassen, im Gegenteil: Neben Brasilien, das sich wegen seiner chronischen Reformblockaden nach außen erhebliche Blößen gegeben hat, wurden nun auch solche Länder in die Krise gestürzt, an deren wirtschaftspolitischer Orthodoxie kaum Zweifel erlaubt waren. Außer Argentinien waren nun auch zum ersten Mal Chile und Kolumbien massiv betroffen, wohingegen Mexiko - vermutlich dank seiner Einbindung in die NAFTA - diesmal vergleichsweise glimpflich davon kam.
Die von externen Schocks ausgelösten Krisen stellen nicht nur vorübergehende Rezessionen dar: In Lateinamerika leben viele Menschen so knapp an der Armutsgrenze, dass jeder Wachstumseinbruch eine geradezu dramatische Zunahme der in Armut lebenden Menschen nach sich zieht: Mit jedem Prozent Wachstum weniger nimmt die Armut um 2 Prozent zu, und es wurde geschätzt, dass wegen der besonderen Verletzlichkeit Lateinamerikas gegenüber negativen Ausschlägen der Finanzmärkte die Armut dort heute um 33 Prozent höher liegt, als dies ohne die externen Schocks der Fall gewesen wäre.
Angesichts dieser Rückschläge und der insgesamt mageren Ergebnisse der Reformanstrengungen ist von den hoffungsfrohen Erwartungen, die noch zu Beginn und Mitte der 90er Jahre überall zu spüren waren, wenig übrig geblieben. Nach der Asienkrise nehmen die Zweifel an der Tragfähigkeit des neuen Entwicklungskonzepts offenkundig zu: Allenthalben wächst die Kritik am „capitalismo salvaje“, und Umfrageergebnisse machen deutlich, dass auch schon vor der Asienkrise die ökonomische Lage skeptisch und die mageren sozialen Ergebnisse mit wachsender Ungeduld betrachtet wurden. Die oftmals beschworene „soziale Schuld“ ist in den Augen der Betroffenen nach wie vor nicht beglichen, und die wiederholten Rückschläge sind dazu angetan, entsprechende Hoffnungen zu zerstören. Diese Einschätzung reflektieren eine auch mit objektiven Indikatoren belegbare soziale Verletzlichkeit, die in einer Destabilisierung und Informalisierung der Arbeitsverhältnisse und oft auch sinkenden Realeinkommen ihren Ausdruck findet. Wie sehr die Stimmung am Kippen ist, mag die Popularität des Venezulanischen Präsidenten Chávez verdeutlichen, der mit neopopulistischen Parolen und Gesten zum Hoffnungsträger für eine offenbar zutiefst verzweifelte Bevölkerung geworden ist.
Ursachen der Armut in Lateinamerika
Wenn man sich bei der Analyse der Ursachen der Armut in Lateinamerika auf die Phase der Schuldenkrise und nachfolgenden Anpassungspolitik beschränkt, ist dies eine höchst problematische Einengung der Untersuchungsperspektive. In Lateinamerika ist das Niveau der Armut auch vor der Schuldenkrise sehr viel höher gewesen als in anderen Regionen der Welt, deren Entwicklungsniveau bis in die 60er Jahre noch weit unter dem Lateinamerikas gelegen hat.
Wer das hohe Niveau und die Persistenz von Armut in Lateinamerika begreifen will, muss weit in die Geschichte zurückgehen. Sie hängen mit Besitz- und Machtstrukturen zusammen, die nie wirklich reformiert worden sind und die in der heutigen Debatte als gegeben vorausgesetzt werden. Die historisch entstandenen Eigentumsstrukturen, welche natürlich auch die vielfach beklagte Einkommensverteilung beeinflusst, und welche die sozialen Chancen in den dortigen Gesellschaften weitgehend determinieren, kommen kaum noch ins Blickfeld. Die Eigentumsfrage zu diskutieren , gilt heutzutage als unschicklich, da dies jene soziale Schicht verschreckt, welche in einer Marktordnung Träger von Wachstum und Fortschritt ist. In der Tat verfügen die vermögenden Schichten in Lateinamerika über „exit options“, wie die z.T. massive Kapitalflucht der 80er Jahre gezeigt hat, die Armen jedoch nur, wenn sie an der Grenze zu den USA leben.
Die Besitz-, Einkommens- und Machtstrukturen können in Lateinamerika mit den spezifischen historischen Formen der Inwertsetzung der Region in Verbindung gebracht werden, welche nicht immer und überall, aber zumeist eine extreme Besitz- und Einkommenskonzentration gDie Besitz-, Einkommens- und Machtstrukturen können in Lateinamerika mit den spezifischen historischen Formen der Inwertsetzung der Region in Verbindung gebracht werden, welche nicht immer und überall, aber zumeist eine extreme Besitz- und Einkommenskonzentration gefordert hat. Der Bergbau ist eine lokal beschränkte wirtschaftliche Tätigkeit, und die frühe Form der dortigen Arbeitsverhältnisse (Zwangsarbeit) ließ ohnehin keine Streuung von Einkommen zu.
Mit der Plantagenwirtschaft und der damit verbundenen Sklaverei verhielt es sich ähnlich. Gerade jene Kolonien, die unter kolonialökonomischen Aspekten im 18. Jahrhundert wegen ihres Reichtums und der Abschöpfungsmöglichkeiten als besonders wertvoll galten, erhielten im Laufe ihrer Entwicklung eine hochgradig polarisierte Besitz- und Sozialstruktur, welche sich später in der Industrialisierungsphase als Entwicklungshindernis herausstellte. Ökonomisch uninteressante Regionen wie etwa das Hochland von Costa Rica, der brasilianische Süden oder der kolumbianische Bundesstaat Antioquia konnten Siedlerökonomien herausbilden, in denen es keine fabulösen Reichtümer zu verdienen gab, und die sich mit ihrer vergleichsweise egalitären Besitzverteilung heute als sozial ausgeglichen darstellen.
Die Zugriffsmöglichkeiten auf indigene Arbeitskräfte brachten immer besonders rückständige Formen von Arbeitsverhältnissen hervor, die sich dann später als schwer reformierbar erwiesen. In Regionen mit Arbeitskräfteknappheit wie in Argentinien und Uruguay entstanden schon früh Lohnarbeitsverhältnisse und eine deutlich bessere Einkommensverteilung als anderswo.
Die populistischen Ansätze seit den 30er Jahren haben es nicht vermocht, die polarisierten Sozialstrukturen zu überwinden. Zwar hat sich der Anteil der Mittelschichten und Industriearbeiter erhöht, doch hat die Segmentierung von Arbeitsmärkten die Trennlinie zwischen dem formellen und informellen Sektor erst so richtig hervorgebracht. Es scheint, als schaffe jede Entwicklungsphase in Lateinamerika ihre eigenen Formen der sozialen Ausschließung, ohne dabei die alten zu überwinden. Wir haben es gewissermaßen mit einer historischen Akkumulation von sozialen Entwicklungsdefiziten zu tun.
Der jüngste entwicklungspolitische Paradigmenwechsel hat diese Strukturen nicht hervorgebracht, er hat die in ihnen angelegte soziale Ungerechtigkeit, wie es scheint, nicht einmal verschärft, aber er hat sie auch nicht verringert. Der Markt als Regulierungsmechanismus operiert heute noch in vielen Ländern Lateinamerikas in Strukturen, in denen die Chancen extrem ungleich verteilt sind, und die eine rein marktgesteuerte Verteilung zwangsläufig ungleich ausfallen lassen. Man sollte sich daher davor hüten, die Durchsetzung von Marktregeln nach der Eliminierung von verzerrenden Staatseinflüssen in Lateinamerika als Rückkehr zu einer Art gesellschaftlichen Urzustand zu feiern, in dem alle ihre Chance erhalten. Sie können zwar alte Verteilungskoalitionen zerschlagen, sie bringen aber von sich aus noch keine Strukturen hervor, die man als „gerecht“ bezeichnen könnte.
Fazit
Wie immer man „Neoliberalismus“ definiert: Die vorgelegten Befunde belegen die weit verbreitete These nicht, dass die mehr oder minder radikale Umstellung auf Marktsteuerung im Laufe der 90er Jahre zu einer Verschärfung der sozialen Krise geführt habe. Ein wesentlicher Erfolg der Reformen lag in der Reduzierung der Inflation, die sich heute im ein- bis zweistelligen Bereich bewegt, nachdem sie noch in wichtigen Ländern des Subkontinents um 1990 drei- bis vierstellige Werte aufzuweisen hatte. Mehr als alles andere hat dies die Situation der Armen verbessert, da sie sich nie der üblichen Schutzmechanismen gegen die Inflation bedienen konnten, über die andere soziale Schichten verfügten (Kapitalflucht, indexierte Konten, Flucht in Sachwerte).
Die Inflation hat lange Zeit als eine Art Armensteuer funktioniert, was vielleicht auch die überraschend hohe Inflationstoleranz in Lateinamerika erklärt. Erst nachdem die Inflation solche Dimensionen angenommen hatte, dass sie auch für die reicheren Teile der Bevölkerung jegliche ökonomische Kalkulierbarkeit zerstört und verschiedene Regierungen immer wieder zu überfallartigen und z.T. aberwitzigen „Stabilisierungsschocks“ veranlasst hatte, erwiesen sich seriöse Stabilisierungsprogramme als politisch durchsetzbar. Der Erfolg bei der Inflationsbekämpfung hat auch solchen Regierungen hohe Popularitätswerte verschafft, die einen vergleichsweise radikalen Kurs verfolgt haben. Sowohl Menem in Argentinien und Fujimori in Peru wurden wieder gewählt, obwohl - oder vielleicht weil – sie sich als radikale Reformer profiliert hatten.
Die Marktreformen haben in Lateinamerika keine soziale Katastrophen hervorgerufen, sie haben aber auch nicht zum Abbau der sozialen Polarisierung beigetragen. Dies kann der Markt auch nicht. Eine Sozialpolitik, welche die enormen Effizienzreserven ausschöpfen würde, und die zudem Chancen der Armen in der Marktwirtschaft verbessern würde, gibt es erst in Ansätzen, und selbst manche dieser Ansätze sind aus politischen Gründen wieder ins Gegenteil verkehrt worden. Das Versagen der Sozialpolitik ist aber nicht dem Markt anzulasten. Sie ist ein Problem der Politik, das sich nicht von alten klientelistischen Legitimierungsmustern zu befreien vermag, und die letztendlich doch wieder den Verteilungsvorstellungen von Eliten folgt, denen „soziale Gerechtigkeit“ allenfalls ein rhetorisches Anliegen ist.
Hinzu kam, dass zwei extreme Schocks in den 90er Jahren in vielen Ländern die Wohlfahrtsgewinne, die sich auch und gerade für die ärmeren Schichten aus der ökonomischen Stabilisierung ergeben haben, weitgehend ausgelöscht haben. Nun kann man argumentieren, dass externe Schocks und ihre Folgen durchaus auch eine Folge der stärkeren Weltmarktorientierung und der Marktöffnung sind. Das ist sicher richtig, doch solange es zu beidem keine wirkliche Alternative gibt, auch irrelevant. Überdies kann man zeigen, dass einige politische Entscheidungen in Lateinamerika selbst die Spekulationsanfälligkeit erhöht und die Stabilisierungskosten besonders brutal haben ausfallen lassen. Die starre Bindung des argentinischen Peso an den US-Dollar lassen der dortigen Regierung in der Tat keine Wahl, als bei Spekulationsattacken mit Einkommenssenkungen zu reagieren. Die starre Dollarbindung kann übrigens gerade nicht als typisch neoliberale Maßnahme gelten. Sie wurde auch von sehr orthodoxen Ökonomen heftig kritisiert. Dass auch Brasilien in den Sog der Asienkrise geraten ist, hängt nicht zuletzt mit dem Reformstau in diesem Lande zusammen, der eine Haushaltskonsolidierung verhindert und zu Spekulationsattacken geradezu herausgefordert hat. Allerdings ist auch ein Land wie Chile, dessen Wirtschaftspolitik auch bei den konservativsten Ökonomen über jeden Zweifel erhaben war, davon betroffen worden, wobei dieser Schock vor allem wegen des hohen Anteils Asiens am chilenischen Außenhandel realwirtschaftlich vermittelt war.
Da die hohe externe Verletzlichkeit Lateinamerikas in einer hohen sozialen Verletzlichkeit gerade der ärmeren Schichten resultiert, gerät die politische Stabilisierung des neuen Entwicklungsmodells zunehmend in Gefahr. Man müsste das nicht bedauern, wenn es denn eine tragfähige Alternative gäbe, die bessere soziale Resultate zeitigen würde. Dies ist gerade nicht der Fall. Was wir heute beobachten können, sind neopopulistische Tendenzen, die mit Sicherheit die Krise verschärfen und nicht lindern und darüber hinaus auch die politischen Stabilitätsgewinne aufs Spiel setzen. ·