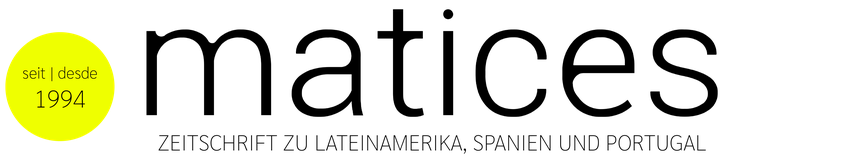Aufstieg oder Abstieg?
Transformation und Kontinuität in Kuba
von Bert Hoffmann
Spektakulär sind in der Regel große politische Veränderungen. In Kuba ist es ihr Ausbleiben. Aller Krise zum Trotz bekräftigte acht Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer der V. Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas ohne Abstriche die führende Rolle der Partei in Staat und Gesellschaft, die sozialistische Wirtschaft frei von privatem kubanischen Unternehmertum sowie die personelle Kontinuität der Staatsführung durch Fidel Castro – und für den Fall seines Ablebens durch seinen Bruder Raúl.
Erklärung verlangt in Kuba so nicht ein grundlegender politischer und wirtschaftlicher Systembruch, erklärungsbedürftig sind vielmehr die Prozesse und Faktoren, die diesen verhindert haben. Die 'doppelte Identität' Kubas als lateinamerikanisches und sozialistisches Land stellt eine solche Analyse, wie in einem ersten Schritt gezeigt werden soll, in den Schnittpunkt der Transitionsforschung einerseits, die sich in Auseinandersetzung mit den Demokratisierungsprozessen in Südeuropa und Lateinamerika entwickelt hat, und der Transformationsforschung andererseits, wie sie an den Umbrüchen in den sozialistischen Staaten Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion ansetzt. Für die Transformationsprozesse in Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion ist von dem "Dilemma der Gleichzeitigkeit" (Offe, 1994) gesprochen worden. Denn im Unterschied zu Südeuropa und Lateinamerika, wo die Transition als Übergang zur Demokratie zwar einen politischen Regimewechsel bedeutete, nicht aber das ökonomische System grundsätzlich in Frage stellte, war in den ehemals sozialistischen Staaten beides gleichzeitig zu bewältigen, ein politischer und ökonomischer Systemwechsel.
Für Kuba stellt sich, die Frage nach dem Verhältnis zwischen ökonomischem und politischem Wandel in besonderer Form. Denn angesichts der grundlegend veränderten internationalen Bedingungen seit 1989 ist auch in Kuba die Reproduktion der politischen Herrschaft eben nicht, wie vielfach angenommen oder suggeriert, durch schlichtes 'Beibehalten des Status quo' möglich gewesen, sondern nur durch ein erhebliches Maß an Veränderungen, die im Rahmen des bestehenden Systems durchgesetzt oder zumindest hingenommen wurden. So vollzieht sich die Fragmentierung und Informalisierung der Ökonomie, die für die postsozia-listischen Länder Osteuropas so prägend ist, auch in Kuba; allerdings geschieht dies hier im Rahmen des nach wie vor sozialistischen Staates. Sie untergräbt zwar einerseits die 'klassische' sozialistische Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, erweist sich aber andererseits, so das Argument, als die für den politischen Machterhalt funktionalste Form des Rückgriffs auf Marktmechanismen.
Das "Dilemma der Gleichzeitigkeit" in den ehemals sozialistischen Staaten umfaßt allerdings noch eine dritte Ebene, die Offe "die Territorialfrage" nennt. In einem weiteren Sinne ließe sich dies als 'Frage der Nation' fassen – also der ganze Komplex von Souveränität, Integrität und Identität des Nationalstaats, seiner Affirmation oder Infragestellung (und damit verbunden auch die Rolle externer politischer Akteure) sowie von ethnisch und nationalistisch geprägten Bewegungen und Legitimationsmustern. Für den Sturz der kommunistischen Regime in Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion erlangten diese Faktoren zentrale Bedeutung; in den Demokratisierungsprozessen in Lateinamerika hingegen spielten sie meist eine nur untergeordnete Rolle.
Im Unterschied zu den Transitionen in Lateinamerika jedoch stellt sich in Kuba in der Tat mit der 'politischen' gleichzeitig auch die 'nationale' Frage; aber verglichen mit Osteuropa stellt sie sich sozusagen unter entgegengesetztem Vorzeichen: Die Behauptung der Nation gegen die übermächtige Hegemonialmacht ist in Kuba die Trumpfkarte der sozialistischen Regierung, nicht der Opposition. Wo von der Transitionsforschung die Bedeutung der internen Faktoren für die Demokratisierungsprozesse betont worden ist, erweist sich der 'Sonderfall Kuba' als Beispiel dafür, wie externen Akteuren eine Schlüsselrolle für das Ob und Wie politischer Transitionsprozesse zukommen kann.
Kubas 'doppelte Identität'
Ausgangspunkt der Analyse muß Kubas 'doppelte Identität' als lateinamerikanischer und sozialistischer Staat sein: Das Kuba Fidel Castros war gleichzeitig Teil der 'Dritten Welt' der Entwicklungsländer sowie der 'Zweiten Welt' der sozialistischen Staaten. Diese 'doppelte Identität' prägt bis heute die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen des Landes.
Die kubanische Revolution von 1959 stieß auf die nachdrückliche Feindschaft der USA und fand in der Sowjetunion einen mächtigen Verbündeten. Mit der Verkündung des "sozialistischen Charakters der kubanischen Revolution" war in der Folge eine Übernahme politischer und ökonomischer Modelle von der Sowjetunion verbunden, die vor allem in den siebziger Jahren mit dem sogenannten 'Prozeß der Institutionalisierung', der Verabschiedung einer neuen Verfassung (1970) sowie der Vollmitgliedschaft 1972 im 'Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe' (RGW) fest verankert wurde.
In der lateinamerikanischen Identität Kubas indes stellte die Revolution die Verkörperung des nationalen Unabhängigkeitskampfes des Landes dar. In dieser Sicht war der Konflikt mit den USA nie nur ein 'Ost-West-', sondern immer auch ein 'Nord-Süd'-Konflikt. Hinter den formalen, sozialistisch verfaßten Institutionen blieb die Fundierung der kubanischen Politik in den militärischen, aus dem Guerillakrieg erwachsenen Strukturen erkennbar, und die überdimensionale und unhinterfragbare Führungsfigur an der Spitze ließ ihre Herkunft aus der Tradition lateinamerikanischer Caudilloherrschaft kaum übersehen. Bis heute ist Fidel Castro in erster Linie 'Comandante en Jefe' der kubanischen Revolution – ob die Verfassung diesen Titel nun vorsieht oder nicht –, und erst in zweiter Linie Erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Präsident des Ministerrats und des Staatsrats etc. Aus dieser 'doppelten Identität' Kubas ergibt sich, daß die Analyse der jüngeren Entwicklung in der Schnittmenge der lateinamerikanischen Transitions- und der durch die sozialistischen Staaten geprägten Transformationsdebatte liegt. Bemerkenswerterweise lag Kuba jedoch im toten Winkel von beiden. Die Transitionsforschung betrachtete Kuba praktisch nicht. Das vierbändige Standardwerk von O’Donnell et al. (1986) über 'Transitions from Authoritarian Rule' ist in dieser Hinsicht bezeichnend: Es ordnet das sozialistische Kuba en passant den undemokratischen Regimen zu, klammert es jedoch von der Untersuchung explizit aus.
Natürlich ist Kuba ein Sonderfall, schließlich hat dort bislang keine Transition im Sinne eines politischen Systemwechsels zur Demokratie westlicher Prägung stattgefunden. Aber die Frage, warum ein derartiger Prozeß nicht stattfindet, ist ja nur die Kehrseite der Frage, warum er andernorts stattfindet. Und gerade für die vergleichende Betrachtung können die von der aufgestellten Norm 'abweichenden Fälle' in besonderem Maße interessant sein. Allerdings wird Kuba in der Regel auch von der an den ehemals sozialistischen Ländern Osteuropas ansetzenden 'Transformationsforschung' außen vor gelassen. Die Fortexistenz des sozialistischen Systems in Kuba wird hier vielfach als Nichtstattfinden von Transformation gesehen und erscheint damit nicht als Gegenstand der Forschung. Doch wie in den Staaten Osteuropas basierte auch in Kuba das sozialistische Entwicklungsmodell auf einer weitgehenden Abkoppelung vom kapitalistischen Weltmarkt. Und so wie die Transformationsprozesse in Osteuropa immer gleichzeitig als Prozesse der Integration in den Weltmarkt zu verstehen sind, so steht auch Kuba – auch ohne daß ein politischer Systembruch stattgefunden hätte – unweigerlich vor eben dieser Aufgabe einer Neueingliederung in die nunmehr durchgängig kapitalistische Weltwirtschaft. Hieraus ergeben sich Probleme und Prozesse, die die Verknüpfung der Analyse der kubanischen Entwicklung mit der Forschung über die sogenannten 'Transformationsstaaten' Osteuropas nahelegen und fruchtbar machen.
Denn wo der Zusammenbruch der Handelsbeziehungen mit den sozialistischen Staaten dem kubanischen Sozialismus seine bisherigen Existenzbedingungen entzog, war der Erhalt des politischen Systems keineswegs als reines 'Festhalten am Bestehenden', sondern nur durch Veränderungen möglich. In dieser Sichtweise fallen die Begriffe 'Transition' und 'Transformation' auseinander und werden gegenläufig: Gerade weil das System in Kuba – ob gewollt oder ungewollt, ob bewußt oder unbewußt – erhebliche Transformationsprozesse verarbeitet hat, hat es eine 'Transition' im Sinne eines politischen Systemwechsels zu einer Mehrparteiendemokratie westlicher Prägung bislang verhindert.
Krise und Systemerhalt: zur politischen Logik der wirtschaftlichen Transformation.
In den achtziger Jahren wickelte das sozialistische Kuba mehr als 80 Prozent seines Außenhandels mit den Staaten des RGW ab. Damit wird das Ausmaß der Krise erahnbar, die der Abbruch dieser Beziehungen nach 1989 bedeutete. Die kubanische Regierung antwortete darauf mit einer Doppelstrategie: Zum einen wurde ein rigides Notprogramm ausgerufen, dessen offizieller Name 'Sonderperiode in Friedenszeiten' bereits darauf hinweist, daß es eine Adaption eines für Kriegszeiten entwickelten Konzepts ist. Den massiven Versorgungsengpässen und dem scharfen Fall des allgemeinen Lebensstandards wurde mit einer nahezu vollständigen Rationierung aller Produkte begegnet, die die Kosten der Krise weitgehend egalitär verteilen sollte: "Was wir in diesem Moment haben, ist praktisch eine Kriegswirtschaft", so Fidel Castro selbst (1991).
Auch bei derart stark gedrosseltem nationalen Konsum blieb für die strukturell außenhandelsabhängige kubanische Ökonomie eine Reintegration in die veränderte Weltwirtschaft unvermeidlich. Unter dem Zwang zur Devisenerwirtschaftung wurde so parallel zu der kriegswirtschaftlichen Austeritätspolitik in der Binnenökonomie ein neuer, weltmarktorienter und auf dem US-Dollar basierender Sektor in der kubanischen Wirtschaft geschaffen. Zentrale Elemente dabei waren die Öffnung für Joint-venture-Betriebe mit Auslandskapital und der forcierte Ausbau des internationalen Tourismus. Im Umfeld dieser Dollarenklaven sowie im Im- und Exportsektor wurden zudem parastaatliche kubanische Unternehmen etabliert, die auf Devisenbasis operieren und in ihrer Struktur und Organisation offen an kapitalistische Formen angelehnt sind.
Darüber hinaus hat die Regierung, seit sie im Juli 1993 die Legalisierung des Dollarbesitzes in Kuba verfügte, im ganzen Land eine Vielzahl staatlicher Devisengeschäfte eingerichtet, die für alle Kubaner frei zugänglich sind. In der Folge ist die 'Überweisungs-Ökonomie' zu einem zentralen Standbein der kubanischen Volkswirtschaft geworden: Offiziellen Schätzungen zufolge erhält Kuba seit 1994 mehr Dollars durch Geldsendungen der Auslandskubaner an ihre Verwandten auf der Insel als durch das Hauptexportprodukt Zucker.
Erst mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Handelspartner erhielt auch das seit Anfang der sechziger Jahre bestehende Handelsembargo der USA gegen Kuba sein volles Gewicht. Wo Havanna näher an Miami liegt als Leipzig an Bonn, wären die USA Kubas 'natürlicher' erster Markt für fast alle Waren und Dienstleistungen. Durch das Embargo Washingtons sieht sich Kuba so nicht nur den Zwängen des Weltmarkts ausgesetzt, sondern mehr noch einem machtpolitisch empfindlich beschnittenen Weltmarkt. Ohne Frage stellt diese – seit 1989 mehrfach verschärfte – Embargopolitik der USA ein außerordentliches Hindernis für jegliche wirtschaftspolitischen Pläne Kubas dar.
Die Konsequenz der von der kubanischen Regierung eingeschlagenen Doppelstrategie von 'Kriegswirtschaft zum Dollarenklaven' war eine Spaltung der Ökonomie, die für die kubanische Bevölkerung überaus bitter ist. Der spärlich gewordenen Versorgung über die Rationierungskarte stehen die staatlichen Dollarshops gegenüber, in denen es alles gibt, von Brot und Fleisch bis hin zum importierten Kühlschrank und Sony-Farbfernseher – wohlgemerkt, alles frei zu kaufen für jeden Kubaner und jede Kubanerin, solange diese über das entsprechende Geld, sprich: genügend US-Dollars, verfügen. Damit aber findet die Weltmarktkonkurrenz und auch die internationale Währungskonkurrenz in Kuba selbst und für alle sichtbar statt. Und durch den Absturz der sozialistischen Ökonomie und der nationalen Währung findet sie in sehr krasser Form statt.
Trotz der drastischen Reduzierung des Warenangebots hatte das Krisenmanagement der Regierung die staatlichen Preise und Löhne künstlich konstant gehalten. Im Ergebnis nahm die Menge des im Umlauf befindlichen Geldes zwischen 1989 und 1991 um 47 Prozent zu, während gleichzeitig der Warenumsatz im Einzelhandel um 30 Prozent zurückging. Die Konsequenz war ein dramatischer Wertverfall der kubanischen Währung. Der Durchschnittslohn der staatlichen Wirtschaft von 180 Pesos entspricht damit heute umgerechnet gerade noch neun US-Dollar – als Monatsverdienst. Eine derartige Verzerrung der monetären Beziehungen reißt eine tiefe soziale Kluft auf: Was ein Stahlarbeiter als Monatslohn verdient, erhält ein Kellner in einem Devisenhotel leicht als Trinkgeld bei einem Frühstück.
Die Transformation in Osteuropa wird vielfach als Entwicklung "Vom Plan zum Markt" (Weltbank 1996) gefaßt. Dagegen ist argumentiert worden, daß in den ehemals sozialistischen Ländern vielfach eben nicht ein Übergang einfach "Vom Plan zum Markt" stattgefunden hat, sondern daß vielmehr hybride Mischstrukturen entstanden sind; daß sich Ökonomie und Gesellschaft eben nicht einheitlich in eine Richtung entwickeln, sondern daß sie sich entlang des Geldes fraktioniert und gespalten haben; und daß an die Stelle der alten Planwirtschaft keineswegs 'der Markt' getreten ist, sondern vielmehr durch Informalisierung geprägte Mischstrukturen, in denen sich noch bestehende Elemente des sozialistischen Staates sowie die Kooperationsbeziehungen der alten Partei- und Planeliten mit den neuen Marktstrukturen vermischen. So wie in den ehemals sozialistischen Staaten entsprach auch in Kuba der Krise der formellen Wirtschaft – die offiziellen kubanischen Zahlen nennen von 1989 bis 1993 einen Rückgang des BIP um -34,8 Prozent – ein ebenso massives Anwachsen des Schwarzmarkts und der informellen Ökonomie. Die Zahlenangaben hierfür sind naturgemäß vage. In einem vielbeachteten Aufsatz nannte der kubanische Reformökonom Julio Carranza 1992 erstmals Zahlen, die bis dahin unveröffentlicht geblieben waren: "1990 zirkulierten auf dem Schwarzmarkt schätzungsweise 2 Milliarden Pesos (nach Angaben des Instituto de Demanda Interna), und in den vergangenen zwei Jahren hat sich diese Zahl wahrscheinlich verfünffacht." Da der Geldumlauf des offiziellen staatlichen Einzelhandels zur gleichen Zeit circa sieben Milliarden Pesos betrug, wurde demnach auf dem Schwarzmarkt deutlich mehr Geld umgesetzt als in der formellen Wirtschaft.
Es ist davon auszugehen, daß sich bis zum Tiefpunkt der Krise in den Jahren 1993/1994 dieses Verhältnis weiter stark zuungunsten der formellen Wirtschaft verschob. Diese Relationen beziehen sich wohlgemerkt auf den in Geld gemessenen Wert der Waren, nicht ihr Volumen. Angesichts hochsubventionierter Preise in der Staatswirtschaft und der hohen - zunehmender Inflation ausgesetzten - Preise auf dem Schwarzmarkt ist das Verhältnis in der Warenmenge erheblich weniger kraß. Gleichwohl gingen inoffizielle kubanische Schätzungen davon aus, daß bis zu 50 Prozent der im Land verbrauchten Konsumgüter nicht über die formelle Ökonomie gehandelt wurden, sondern über informelle Strukturen, Schwarzmarktgeschäfte aller Art, Familienbeziehungen, privates, nicht legalisiertes Gewerbe, Tauschgeschäfte etc. Die Ursachen für den Boom der informellen Wirtschaft in Kuba sind dabei, wenn auch nicht identisch, so doch durchaus verwandt mit denen in den postsozialistischen Staaten. In beiden ist die Informalisierung der Ökonomie nicht nur ein 'Überleben alter Strukturen', sondern sie speist sich gleichzeitig auch aus einer zweiten, neuen Quelle: den geldwirtschaftlichen Verhältnissen, die Einzug halten und die breite Bevölkerungsteile ökonomisch exkludieren. Wer in dieser formellen Geldwirtschaft chancenlos ist, entzieht sich ihr fast zwangsläufig durch das Ausweichen in die informelle Ökonomie. Wenn in bezug auf die ehemals sozialistischen Staaten von der 'Peripherisierung Osteuropas' die Rede ist, findet in diesem Sinne eine 'Lateinamerikanisierung Kubas' statt.
In Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion hat "vor allem die tiefgreifende Erschütterung und/oder Auflösung der real-sozialistischen Erwerbsstrukturen und sozialen Sicherungssysteme [...] eine umfassende gesellschaftliche 'Entsicherung' zur Folge" gehabt, wie Hopfmann (1997) schreibt. "Für eine Vielzahl von Akteuren kann diese existenzbedrohende Unsicherheit nur durch eine Kombination von 'Überlebensstrategien' – das Festhalten an überkommenen interpersonellen Netzwerken [...], durch den partiellen Rückzug in die Selbstversorgungswirtschaft und/oder die Aufnahme von prekären Arbeitsverhältnissen (jenseits institutionalisierter Regulative) – einigermaßen 'beherrscht' werden."
Nun besteht in Kuba, im Unterschied zu den Staaten Osteuropas, die formelle sozialistische Staatswirtschaft fort. Dennoch besteht kein Zweifel, daß auch in Kuba die 'realsozialistischen Erwerbsstrukturen' tiefgreifend erschüttert sind – weniger in Form von Betriebsschließungen, Entlassungen und offener Arbeitslosigkeit als vielmehr durch die dramatische Entwertung der Pesolöhne. Wo diese nur noch in geringem Maße über die tatsächliche Möglichkeit des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen entscheiden, werden alle anderen Arten von Erwerbsmöglichkeiten ungleich wichtiger (ob legale, illegale oder in der weiten Grauzone dazwischen). Ähnliches gilt für die sozialen Sicherungssysteme, sofern sie monetär vermittelt sind. Wo die durchschnittliche Rente von 80 Pesos dem offiziellen Umtauschkurs zufolge weniger als vier US-Dollar monatlich beträgt, bringt ein Mangobaum im Garten im Zweifel mehr Geld ein.
Wenn Hopfmann schreibt: "Informalisierung ist zunächst eine unmittelbare Konsequenz des Systemzusammenbruchs und der 'proklamierten Wende zu Marktwirtschaft und Konkurrenzdemokratie'", dann mag der Fall Kuba dies ein Stück weit relativieren. Denn in Kuba vollzieht sich die weitgehende Informalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen eben auch ohne daß eine politische 'Wende' vorangegangen wäre. Die "Erosion des Staates" und die "Entsicherung reproduktiver Zusammenhänge" (Hopfmann) führen auch dann zu massiven Informalisierungsprozessen, wenn sie unter dem Dach von Staatssozialismus und Kontinuität des Einparteienstaates erfolgen. Es liegt auf der Hand, daß sich aus diesen ökonomischen Entwicklungen weitreichende soziale und politische Konsequenzen für ein System ergeben, das auf (relativer) gesellschaftlicher Gleichheit basierte und sich in starkem Maße durch seine sozial-ökonomischen Leistungen legitimierte. Auch zentrale 'Errungenschaften der Revolution', allen voran das kostenlose Bildungs- und Gesund-heitssystem, haben unter der Wirtschaftskrise enorm gelitten. Den Ärzten fehlt es an Medikamenten, in den Krankenhäusern an Röntgenplatten und sterilen Operationsfäden, in den Schulen an Stiften, Papier und Büchern. In beiden Bereichen hat die Entwertung der Löhne zu einem spürbaren Abfluß qualifizierten Personals geführt – und zu großen materiellen und Moti-vationsproblemen bei den Verbleibenden.
Die Liste der Erosionserscheinungen von Kubas sozialistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ließe sich lange fortsetzen. Eine Trendwende ist hier kaum in Sicht; die wirtschaftlichen Erholungs-tendenzen, die es seit 1993/94 gegeben hat, beschränken sich ganz weitgehend auf die Export- und Dollarsektoren. Gleichwohl ist es wichtig zu sehen, daß es immer noch einen Grundbestand an sozialstaatlichen und ökonomischen Leistungen der 'alten' sozialistischen Strukturen gibt, denen essentielle Bedeutung für das gesellschaftliche Gefüge zukommt. Die staatliche Versorgung mit subventionierten Lebensmitteln über die Rationierungskarte zum Beispiel ist im Vergleich zu den achtziger Jahren drastisch reduziert, und sie reicht effektiv für niemanden mehr zur Deckung des täglichen Bedarfs. Aber sie garantiert doch einen fast kostenlos zu beziehenden Grundstock an Reis, Bohnen, Speiseöl etc. Und gerade angesichts der Krise und der monetären Diskrepanzen sind die rationierten Produkte für diejenigen, die nicht oder kaum an den neuen geldwirtschaftlichen Verhältnissen teilhaben, unverzichtbarer denn je geworden. In den Werkskantinen und staatlichen Cafeterias sind Qualität und Quantität der Mahlzeiten niedrig, aber auch die Preise fast symbolisch (und die Warteschlangen lang). Wenn die so kraß verzerrten Geldbe-ziehungen, wie sie sich in den Pesolöhnen und dem Wechselkurs des Dollars spiegeln, tatsächlich der alles dominierende Mechanismus wären, der über den Zugang zu Waren, Privilegien und gesellschaftlicher Stellung entschiede, wäre die soziale Situation zweifelsohne sehr viel extremer polarisiert.
Die Informalisierungsprozesse in der kubanischen Wirtschaft haben sich in einem Maße ausgeweitet, daß sie ohne Frage einen Legitimationsverlust für das sozialistische System darstellen. Gleichzeitig aber werden die informellen Strukturen weitgehend toleriert – das Ausmaß, das sie erreicht haben, wäre ansonsten schlichtweg nicht möglich. De facto läßt der kubanische Staat die informelle Wirtschaft eine zentrale Funktion in der Versorgung der Bevölkerung übernehmen, die für die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens im Land überhaupt nicht wegzudenken ist. Wo die staatliche Wirtschaft die Versorgung nicht mehr ausreichend gewährleisten kann, findet auf diese Weise effektiv ein Rückgriff auf Marktmechanismen statt, selbst wenn keine formellen Marktreformen durchgeführt werden.
Diese Politik der De-facto-Tolerierung einer breiten informellen, letztlich nichtlegalen Wirtschaft folgt weniger einer ökonomischen als vielmehr einer politischen Logik: Sie erweist sich als die für den politischen Machterhalt funktionalste Form von Marktmechanismen – selbst wenn sie eine alltägliche Mißachtung der offiziellen Normen und Gesetze zum Normalzustand macht. Wichtiger aber ist, daß, wo die marktwirtschaftlichen Aktivitäten nicht formalisiert und legal sind, daraus auch keine Ansprüche abgeleitet und keine Forderungen erhoben werden können, daß keine Organisierung der Produzenten stattfinden kann und daß der Staat jederzeit freie Hand hat, gegen unerwünschte oder zu große Ausmaße annehmende Aktivitäten einzugreifen. Gerade die Rechtsunsicherheit dieser Marktbeziehungen macht sie jederzeit abhängig vom Wohlwollen der staatlichen Instanzen; dies nimmt ihnen zum einen ihren politischen Stachel, zum anderen bieten sich dadurch auf allen Ebenen Möglichkeiten, administrative Positionen und Kontrollfunktionen in materiellen Nutzen umzumünzen.
Eine andere Frage allerdings ist, ob sich aus dieser Strategie der Regierung auch Entwicklungsperspektiven für das Land ergeben. Das Argument der Reformökonomen in Kuba ist, daß eine derart informelle und klein gehaltene Wirtschaftsstruktur zwar als Krisenmanagement eine ganze Zeit lang funktionieren mag, daß sich darauf aber nicht dauerhaft eine Volkswirtschaft aufbauen läßt – und schon gar nicht eine, die ein Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsystem für elf Millionen Kubaner erhalten und finanzieren will. Statt dessen plädierten sie – allen voran die Wissenschaftler vom Zentrum für Amerika-Studien in Havanna – für eine schrittweise, aber umfassende und kohärente Reform des Wirtschaftsmodells: "den Schritt von dem klassischen Modell des Sozialismus zu einem anderen Modell von Sozialismus [...], das dem Markt eine wenn auch nicht ausschließliche oder vorherrschende, aber doch aktive Rolle bei der Verteilung der Ressourcen und dem allgemeinen Funktionieren der Ökonomie zuweisen sollte." (Carranza et al. 1995) Die kubanische Reformdiskussion dreht sich so genaugenommen weniger um die Frage der 'Einführung' von Marktmechanismen, sondern vielmehr um die Frage, welche Art von Marktmechanismen dies sein sollen:
formelle und rechtlich abgesicherte, die eine weitergehende wirtschaftliche Dynamik entwickeln können – oder lediglich tolerierte, aber prinzipiell illegale Marktmechanismen, die ökonomisch zwar viel schwächer bleiben, die aber politisch sehr viel kontrollierbarer scheinen.
Nach 1993 hatte es vorsichtige Schritte in die erste Richtung gegeben. So wurde für eine Reihe von Berufen 'Arbeit auf eigene Rechnung' zugelassen, die in der Praxis jedoch zahlreichen Beschränkungen unterliegen und mit weniger als 200.000 Registrierten bislang nur begrenztes wirtschaftliches Gewicht erlangt haben. Zu der bislang weitreichendsten binnenwirtschaftlichen Marktöffnung hingegen kam es offensichtlich aus politischen Gründen, als Reaktion des Staates auf den offenen Ausbruch der sozialen Krise im Sommer 1994. Damals war es in Havanna zu den ersten (und bislang einzigen) offenen Unruhen gegen die Regierung Castro und im Anschluß zu einer großen Fluchtbewegung gekommen, bei der mehr als 30.000 Kubaner auf improvisierten Flößen das Land verließen. Nur eine Woche, nachdem Fidel Castro die Seegrenzen Kubas wieder für geschlossen erklärt hatte, ließ er seinen Bruder Raúl Castro – seines Zeichens Armeechef Kubas – die Eröffnung von Märkten für Nahrungsmittel bekanntgeben; und Raúl Castro begründete diesen Schritt auch explizit damit, daß die Nahrungsmittelversorgung die oberste "wirtschaftliche, politische und militärische Priorität" des Landes sei. Aus der Zulassung der lange abgelehnten Bauernmärkte folgte jedoch nicht eine weitergehende Lockerung der Binnenwirtschaft nach dem Muster Vietnams oder Chinas. Die Zulassung privater Kleinrestaurants im Juni 1995 markierte den vorläufigen Höhepunkt der Entwicklung. Wo die einen auf eine graduelle Ausweitung der Reformen gehofft hatten, setzten die anderen auf deren Eindämmung. Bereits Ende des Jahres ging es vornehmlich um vermehrte Kontrollen und Restriktionen. Im Frühjahr 1996 dann verlas Raúl Castro einen 'Bericht des Politbüros', der in martialischer Sprache die Reformdiskussionen insgesamt zu "subversiven Machenschaften" und die daran beteiligten Intellektuellen zur "Fünften Kolonne des Feindes" erklärte (Hoffmann 1997a). Seitdem hat die Position der 'Eindämmung' die Oberhand. Die Absage an marktorientierte Reformen wird dabei explizit mit der damit verbundenen politischen und ideologischen Gefahren begründet und auf diese Weise jeglicher ökonomischer Diskussion entzogen. So schreibt der Leiter der zentralen Parteihochschule der kubanischen KP, Raúl Valdés Vivó, in einem programmatischen Leitartikel in der Parteizeitung Granma Internacional: "Die Schaffung der Keime einer lokalen Bourgeoisie würde eine soziale Kraft einführen, die früher oder später der Konterrevolution zu Diensten wäre". Es ist zu unterstreichen, daß die De-facto-Tolerierung der informellen Ökonomie von all diesen Auseinandersetzungen praktisch nicht betroffen war. Zwar gibt es immer wieder Razzien, Beschlagnahmungen und auch Verhaftungen, aber es hat zu keinem Zeitpunkt einen Versuch gegeben, flächendeckend Recht und Ordnung in der Ökonomie durchzusetzen. Solange über den informellen Marktaktivitäten das Damoklesschwert prinzipieller Illegalität schwebt, kann aus ihnen keine 'soziale Kraft' entstehen, in der die KP-Führung ein politisches Problem sehen würde.
Kubas 'Zweite Ökonomie' ist also fern davon, "von hinter den Kulissen auf die Mitte der Bühne" zu treten, wie es der Titel der umfassendsten internationalen Studie zu dem Thema formuliert (Pérez-López, 1995). Im Gegenteil: Die politische Bedingung für ihre Existenz ist gerade, daß sie hinter den Kulissen bleibt. Dennoch stellt ihre faktische Ausweitung und Veralltäglichung eine strukturelle Transformation innerhalb eines Systems dar, das einst auf einem omnipräsenten Staat basierte, der für praktisch alle Belange des einzelnen und der Gesellschaft zuständig war.
Wo die Forschung zu Osteuropa zunehmend neben dem großen Umbruch auch die weiterwirkenden Kontinuitäten ins Blickfeld nimmt, geht es in Kuba umgekehrt darum, jenseits der großen Kontinuität auf der politischen Ebene die Brüche und Veränderungen dahinter zu erkennen. Wie in den Transformationsstaaten Osteuropas ist es auch in Kuba essentiell, die Transformation eben nicht nur als "Vom Plan zum Markt" zu denken oder die Betrachtung auf die offiziell durchgeführten Reformen zu beschränken. Statt dessen geht es darum, gerade auch die informalisierten Mischformen analytisch in den Blick zu bekommen – und diese Informalisierung nicht als 'Defekt' zu sehen, sondern als durchaus funktionale Konstruktion, die einer politischen Logik folgt und die im Falle des sozialistischen Kubas in erheblichem Maße zum politischen Machterhalt beigetragen hat.
Die Transition, die nicht stattfand: zum Dilemma der Gleichzeitigkeit von politischer und nationaler Frage
Ein weiterer Schlüssel für die Analyse des 'Sonderfalls Kuba' liegt in der eingangs genannten 'dritten Ebene der Gleichzeitigkeit', die als 'Frage der Nation' gefaßt werden kann: die Souveränität und Integrität des Nationalstaats, seine Behauptung oder Infragestellung und, unweigerlich damit verbunden, die Frage nach der Rolle externer politischer Akteure, allen voran nach dem Verhältnis zur dominierenden Hegemonialmacht und den daraus folgenden innenpolitischen Konsequenzen.
Für Kuba hat dies zentrale Bedeutung. Schon daß Kuba in den klassischen Studien der lateinamerikabezogenen Transitionsforschung außen vor blieb, lag nicht zuletzt an der außenpolitischen Einbindung des sozialistischen Karibikstaates. Denn selbst wenn Kuba nie formelles Mitglied des Warschauer Paktes wurde, hatte die Raketenkrise von 1961 doch die Grenzen des Kalten Krieges unmißverständlich auch hier gezogen: Die UdSSR zog zwar ihre Raketen von der Insel ab, aber die USA erkannten im Gegenzug de facto an, daß Kuba zum sowjetischen Einflußgebiet gehörte. Daraus ergab sich in der Folge auch eine Art impliziter Anerkennung der (nie offiziell für Kuba formulierten) Breshnew-Doktrin, die auch die sozialwissenschaftliche Forschung prägte: Solange Kuba Bündnispartner der Sowjetunion war, so die Annahme, war die Frage einer innenpolitischen Demokratisierung kein Thema und Kuba kein sinnvoller Unter-suchungsgegenstand für eine am Leitmodell pluralistischer Mehrparteiendemokratie orientierte Transitionsforschung. Nach 1989 basierte in der Folge die verbreitete Erwartung eines auch in Kuba unmittelbar bevorstehenden politischen Systemwechsels nicht nur auf dem Wegfall der bisherigen Handelsbeziehungen und der absehbar daraus folgenden Wirtschaftskrise, sondern auch auf der grundlegend veränderten außenpolitischen Situation, die für das sozialistische Kuba den ersatzlosen Wegfall seiner langjährigen Hegemonial- und Schutzmacht bedeutete. Eingangs war von der 'doppelten Identität' Kubas als notwendigem Ausgangspunkt der Analyse die Rede. Gerade an diesem Punkt wird deutlich, wie sehr es zu kurz greift, Kuba allein unter dem Blickwinkel seiner sozialistischen Identität zu sehen und entsprechend bruchlos aus dem Ost-West-Konflikt heraus erklären zu wollen. Vielmehr ist gerade in der Frage der internationalen Politik die 'lateinamerikanische Identität' Kubas bis heute prägend, in der die Revolution das Projekt nationaler Unabhängigkeit von den USA darstellt. So massiv seit den sechziger Jahren die reale Abhängigkeit Kubas von der Sowjetunion auch war, so ließ das Wirtschaftsembargo und die fortgesetzte Konfrontationspolitik Washingtons die Allianz mit der Sowjetunion doch immer als Mittel erscheinen, sich gegen die Anmaßungen der 'eigentlichen' Hegemonialmacht USA zu behaupten. Im Unterschied zu den Transitionsprozessen in Lateinamerika ist in Kuba die Frage des politischen Systems in der Tat mit der Frage der Nation verbunden; aber im Vergleich zu Osteuropa und den Republiken der ehemaligen Sowjetunion stellt sie sich sozusagen unter entgegengesetztem Vorzeichen: Die Behauptung der Nation gegen die Hegemonialmacht ist in Kuba die Trumpfkarte der sozialistischen Regierung, nicht der Opposition. Als Kuba seine ideologischen Bündnispartner in Übersee verlor, mußte die nationalistische Legitimierung nicht neu erfunden, sondern nur stärker betont werden. Man nahm Marx nicht von den Wänden, aber ins Zentrum gerückt wurde nun José Martí, der Held des kubanischen Unabhängigkeitskampfes vor 100 Jahren. In der Verfassung wurde Artikel 5 geändert: Die Kommunistische Partei war nun nicht mehr als "Avantgarde der Arbeiterklasse" definiert, sondern als "Avantgarde der kubanischen Nation".
Schon nach der Revolution 1959 war die Frontstellung zu den USA zu dem zentralen auch innenpolitischen Argument des kubanischen Staates gegen die Opposition im Land geworden. Der große soziale Konflikt Kubas, den die Revolution mit ihren Enteignungen und der radikalen Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft bedeutete, wurde in der Folge in entscheidendem Maße durch die Emigration der alten Elite in die USA 'gelöst'. Allein in und um Miami leben heute rund eine Million Kubaner beziehungsweise Kubano-Amerikaner. Und beides, der in die USA exportierte Konflikt der kubanischen Revolution und der traditionelle Hegemonieanspruch der USA, verbindet sich heute auf fatale Weise in der Politik Washingtons gegenüber Kuba. Das Ergebnis ist, daß die US-Politik effektiv jeglicher internen Demokratisierung in Kuba im Wege steht und sie bislang verhindert. In welchem Maße sich damit die politische Frage Kubas heute tatsächlich auch als 'nationale Frage' stellt, zeigt beispielhaft das sogenannte Helms-Burton-Gesetz, das der US-Kongreß 1996 verabschiedet hat (Hoffmann 1997b). Dieses Gesetz macht just die Alteigentümeransprüche der Exilkubaner zum Dreh- und Angelpunkt der Kubapolitik Washingtons. Nun haben jedoch die allermeisten Kubaner, die nach 1959 in die USA emigriert sind, inzwischen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Genau hierin liegt aber der politische Sprengstoff: Das Helms-Burton-Gesetz erhebt die Ansprüche der von der Revolutionsregierung enteigneten kubanischen Bürger per US-Gesetz und als 'Schutz des Eigentums von US-Bürgern'. Juristisch gesehen verstößt diese Konstruktion, die die erst später angenommene US-Staatsbürgerschaft der Exilkubaner rückwirkend für den Zeitpunkt der Enteignungen geltend macht, eklatant gegen internationales Recht sowie gegen die bisherige Justizpraxis der USA selbst. Politisch gesehen interpretiert sie den gesamten innerkubanischen Konflikt der Revolution im nachhinein explizit um zu einem internationalen Konflikt, in dem der revolutionäre kubanische Staat nicht gegen kubanische Bürger, sondern gegen US-Bürger und damit gegen die USA steht – und just in dieser internationalisierten Konstruktion setzt sie diesen Konflikt heute wieder neu auf die politische Tagesordnung. Hilfreicher könnte die Politik der USA kaum sein für die Strategie der kubanischen Regierung, alle internen Auseinandersetzungen umzumünzen in das dichotome Freund-Feind-Schema von 'Kuba versus die USA', 'Nation gegen Imperialismus', 'Mit Fidel oder mit den Yankees'. In dem Maße, in dem diese Frontstellung funktioniert, verhindert die kubanische Führung bislang sehr erfolgreich, daß abweichende politische Meinungen zu einem legitimen Diskurs in der nationalen Politik werden konnten.
Darüber hinaus formulieren die USA im Helms-Burton-Gesetz einen langen und detaillierten Katalog von Bedingungen für eine demokratische Transition in Kuba. Dieser reicht von der Auflösung der Staatssicherheit (§ 205 a, 3) bis zur Ankündigung international überwachter Wahlen (§ 205 a, 4), von der Zulassung privater Medien und Telekommunikationsfirmen (§ 205b, 2A) bis zum Nachweis "angemessener Schritte", um enteigneten US-Bürgern oder -Firmen ihren Besitz zurückzugeben oder sie zu entschädigen (§ 205b, 2D). Die Vorgaben aus Washington reichen bis in die Personalpolitik: "Eine Übergangsregierung in Kuba ist eine Regierung, die [...] weder Fidel Castro noch Raúl Castro beinhaltet" (§ 205a, 7). Aus Sicht kubanischer Funtionäre, so reformorientiert sie auch sein mögen, beschreibt dieser Katalog von Bedingungen weniger eine Übergangsregierung als vielmehr einen bereits vollzogenen, ziemlich kompletten Machtwechsel. Und all dies, wohlgemerkt, definiert per Gesetz der USA.
Wo die US-amerikanische Kubapolitik erklärtermaßen auf Analogien aus Osteuropa setzt, übersieht sie, daß es hierbei kein einfaches 'Nachholen' gibt. Denn nicht nur die USA, sonder auch die kubanische Führung haben gesehen, daß Honecker, Krenz, Berghofer, Wolf und wem sonst noch der Prozeß gemacht wurde – und sie werden ihre Schlüsse daraus gezogen haben. Zumal die Unversöhnlichkeit der Hardliner des kubanischen Exils, ihre von Intoleranz geprägte politische Praxis sowie die Gewalttaten exilkubanischer Extre-misten die Annahme nahelegen, daß das, was im vereinigten Deutschland schon vielfach am Rande des Rechtsstaats lavierte, in einem 'Kuba danach' vermutlich in deutlich weniger zivilen Formen ausgetragen werden könnte.
Zudem formuliert das Helms-Burton-Gesetz auch für das, was die USA schließlich nicht nur als 'Übergangsregierung', sondern als vollwertige 'demokratisch gewählte Regierung' anerkennen würden, weitere Bedingungen und Auflagen. Damit aber zielt das Gesetz darauf, weit über ein Ende der Castro-Ära hinaus die Ecksteine der politischen Verhältnisse in Kuba zu diktieren. Es tritt so in der Tat das Erbe des berüchtigten 'Platt-Amendments' an, jenem 1901 in der kubanischen Verfassung verankerten Zusatz, der den USA das Recht auf Intervention einräumte und zum Symbol für die halbkoloniale Abhängigkeit Kubas von den USA wurde.
Selbst für viele Kubaner, die entschiedene Castro-Gegner sind, ist dies ungenießbar. "Mit dem Helms-Burton-Gesetz würde Kuba von der Diktatur Fidel Castros in die Vormundschaft des US-Kongresses fallen", kritisierte etwa Alfredo Durán, einst Teilnehmer der Schweinebuchtinvasion und heute einer der prominentesten Führer der moderaten Kräfte innerhalb des kubanischen Exils, bei einer Anhörung im US-Senat: "All die Vorgaben in dem Gesetz legen Kriterien für Demokratie in Kuba fest, die zu bestimmen allein das Recht des kubanischen Volkes sein kann" (Cuban Affairs, No. 1-2). Solange aber ein Übergang zur Demokratie in Kuba vor allem als ein per US-Gesetz festgeschriebenes und von dem im Wortsinn reaktionären Teil der Exilkubaner abhängiges "transition government" droht, ist dies für niemanden in Kubas politischer Führung (oder auch nur in leitenden Positionen irgendwo in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft) eine attraktive oder zumindest gangbar scheinende Perspektive.
Letztlich mag die US-Politik weniger auf einen 'Übergang' als vielmehr auf einen 'Untergang' setzen: nicht auf einen Wandel, sondern auf einen Sturz des Systems, vorzugsweise durch einen von der Bevölkerung erzwungenen Abtritt der Regierung Castro. Wo es bei den Umbrüchen in Osteuropa zu einer derartigen Mobilisierung 'von unten' kam, mußte sich jedoch in aller Regel die Unzufriedenheit mit dem Status quo auch mit der Aussicht auf eine bessere Zukunft verbinden. Vor allem drei (miteinander unterschiedlich verknüpfte) Momente waren für diese Hoffnung zentral: das Versprechen auf eine Verbesserung des Lebensstandards durch eine Hinwendung zur Marktwirtschaft; die Anbindung an eine mit materieller Besserstellung assoziierte Gemeinschaft - für viele Länder Osteuropas die Europäische Union oder, prominentestes Beispiel, die in der Parole 'Wir sind ein Volk!' postulierte Vereinigung der DDR mit der BRD; und drittens die 'strahlende Vergangenheit', die in verklärter Form zum 'besseren Ich' der Nation aufgebaut wurde, zu dem man angeblich 'zurückkehren' könne.
In Kuba nun sind gleich alle drei dieser Momente fast unweigerlich mit den Exilkubanern (und damit auch den USA) verbunden. Als die alte Oberschicht, die nach 1959 mehrheitlich das Land verließ, verkörpert das Exil die nostalgisch überhöhten 'goldenen fünfziger Jahre' Kubas vor der Revolution. Zum anderen bietet die wirtschaftliche Erfolgsstory der in die USA emigrierten Kubaner auch den handgreiflichen Beweis für die Versprechen einer liberal-kapitalistischen Wirtschaft (sowie ihrer sozialen Aufstiegschancen). Und schließlich sind die Exilkubaner auch das lebende Plädoyer für die Vorteile einer maximalen Anbindung beziehungsweise Integration in die USA. In dem Maße aber, in dem diese Versprechen einer besseren Zukunft mit den Exilkubanern und den USA assoziiert werden, ist ihnen ein Konflikt vorgelagert, der nicht nur für die Elite auf der Insel, sondern auch für die breite Bevölkerung mit enormer (und begründeter) Angst besetzt ist. Letztlich droht der ganze gesellschaftliche Konflikt der kubanischen Revolution zurückzukehren, der nach 1959 in der Emigration der alten Oberschicht sein Ventil gefunden hatte. Dies umfaßt zum einen die Angst vor den Besitz- und Herrschaftsansprüchen der Exilkubaner – allein die Frage des Wohneigentums in Havanna birgt massiven sozialen Sprengstoff. Zum anderen aber ist es auch die Angst vor dem politischen Umbruch selbst, da er in dieser Konstellation nur als gewaltsame Konfrontation denkbar scheint. Damit aber sind diese Versprechen politisch blockiert; sie scheinen nur in ihrer individuellen Form – als Auswanderung in die USA – möglich, nicht aber als gesellschaftlicher Prozeß.
Mit der Transitionsforschung war in Lateinamerika eine starke Betonung der internen politischen Faktoren verbunden. Das in dieser Hinsicht prägende Werk von O’Donnell et al. begründete dies explizit mit der "Ungewißheit", mit den "sich schnell ändernden Konstellationen" und der "Unterdeterminiertheit" der Transitionsprozesse, weshalb den internen Akteuren überragende Bedeutung zukomme.
In Kuba ist in den letzten zehn Jahren das Gegenteil der Fall gewesen: Die Konstellationen haben sich nicht schnell verändert, sondern fast gar nicht; die Verhältnisse scheinen nicht ungewiß, sondern festbetoniert, nicht unter-, sondern überdeterminiert. Und der Fall Kuba ist ein Beispiel dafür, wie externen Faktoren herausragende Bedeutung für die Frage der Transition zukommen kann. Während in Ost-Europa fast alle Demokratisierungsprozesse gleichzeitig im Namen 'nationaler Selbstbehauptung' geführt wurden, gilt in Kuba, wo die von Fidel Castro geführte Revolution die 'nationale Befreiung' verkörperte, das Umgekehrte: Einen friedlichen und untraumatischen Demokratisierungsprozeß kann es nur dann geben, wenn mit der politischen nicht gleichzeitig auch die nationale Frage gestellt wird. Die Bemühungen der USA und des kubanischen Exils, durch politische Konfrontation und wirtschaftlichen Druck 'Demokratie-Export' zu erreichen, haben genau das Gegenteil zur Folge: Die Stabilisierung des angegriffenen Systems, allen internen Krisenerscheinungen und Legitimationsverlusten zum Trotz.