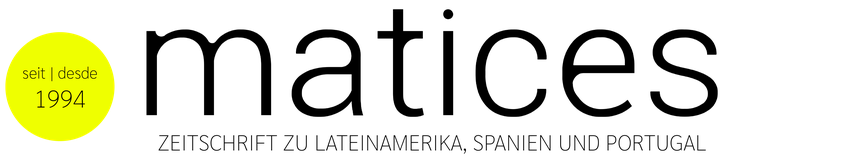Nur Stimmbänder und Muskeln?
Der argentinische Tenor José Cura
von Eckhard Weber
Findige Marketing-Profis präsentierten vor zwei Jahren der Fachwelt und dem Publikum publicityträchtig einen jungen argentinischen Sänger mit dem Prädikat »Tenor des 21. Jahrhunderts«. Da ist man doch zunächst mißtrauisch! Das klingt nach höher, schneller, weiter! Das erweckt Szenarien eines Stimmband-Superstars, der Hallen megamanischer Größe spielend füllt und womöglich mit anderen dickbäuchigen Kollegen in Fußballstadien italienische Kanzonen um die Wette kräht. Oder ist es jemand, der einmal wieder einen Soundtrack für Boxweltmeisterschaften liefert, eventuell im Verein mit einer schmalbrüstigen Möchtegern-Soubrette aus der Musical-Szene? Doch José Cura ist ganz anders.
Er leidet beispielsweise nicht an Verfettung. Wenn er als Titelheld in der Oper Samson und Dalila von Camille Saint-Saëns seinen Oberkörper enblößt, wirkt dies nicht peinlich, sondern legt lediglich einen imposanten Brustkorb und stattliche Bizeps frei. Bodybuilding gehört zu Curas Training genauso wie Gesangsübungen. In einem Interview erklärte er kürzlich: »Der Gesang ist nicht nur eine intellektuelle, künstlerische Disziplin, er ist auch eine physische Disziplin. Alles basiert auf Muskeln, Nerven, Blut, Sehnen, Knochen. Man singt mit dem Körper, den Armen, den Beinen, es ist eine Art Sport.« Diese Haltung ist typisch für eine neue Sängergeneration, die in den letzten Jahren die Bühnen erobert hat. Sie haben erkannt, daß es auf der Opernbühne nicht reicht, sich hinzustellen und schön zu singen. Die Regisseure fordern heutzutage einen Ganzkörpereinsatz. Mittlerweile hat es sich auch in der Provinz herumgesprochen, daß das Rampentheater mit zwei sich anbrüllenden Elefanten nicht mehr gefragt ist.
Daß der Argentinier gut in Form ist, kann man nicht nur sehen, sondern auch hören: Mühelos bewältigt José Cura die schwierigsten Passagen etwa in den dramatischen Arien Puccinis. Überaus souverän entlockt er seinen Stimmbändern kräftige und sicher intonierte Spitzentöne. Von Anstrengung ist ihm nichts anzumerken. Der Sänger hat in seiner Stimme all das, was ein perfekter Tenor braucht: Er verfügt über strahlende Höhen, besitzt eine voluminöse Mittellage und hat ein markiges Fundament. Soviel Sicherheit läßt alles natürlich und leicht klingen. Cura braucht nicht zu forcieren und kann deshalb wohldosiert mit seinen Kräften umgehen. So gelingen ihm auch leise Töne dort, wo andere mit Lautstärke zu retten versuchen, was ihr Organ nicht hergibt.
Dabei war der 1962 in Rosario bei Santa Fe (Argentinien) geborene Cura als Kind kein Stimmwunder, dem man die Solokarriere als Tenor schon an der Wiege gesungen hätte. Seine Musikalität fiel selbstverständlich früh auf. Er nahm zunächst intensiven Gitarrenunterricht und glänzte mit fünfzehn Jahren als Chordirigent. Ein Jahr später begann er ein Studium in Komposition und Dirigieren an der Hochschule von Rosario. Neben seiner Ausbildung pflegte Cura stets den Gesang. In seiner Heimatstadt war er Mitglied in verschiedenen Chören. Ab 1988 rundete er bei dem Lehrer Horacio Amauri seine Gesangstechnik ab. Offensichtlich hatte Cura bei diesem Unterricht endgültig Blut geleckt: Er konzentrierte sich nun intensiv auf den Aufbau einer Sängerlaufbahn. Ihn zog es in das klassische Land der Oper, nach Italien: 1991 schlug er sein Domizil in Verona auf. Erste Auftritte folgten bei Konzerten und auf italienischen Bühnen mit Nebenrollen in Hans-Werner Henzes Märchenoper Pollicino, in Carmen von Bizet und in Verdis Simon Boccanegra. Seine erste Hauptrolle hatte Cura in einer Oper eines Zeitgenossen, dem norwegisch-italienischen Komponisten Antonio Bilbalo: In Triest spielte José Cura 1992 den Jan in Bilbalos Oper Fräulein Julie nach Strindberg. Der Ismael in Verdis Bibeldrama Nabucco über die Gefangenschaft der alttestamentarischen Israeliten in Babylon war Curas erste große Partie in einer Repertoire-Oper.
Curas Durchbruch gelang schließlich im Jahre 1994, als er den unter Plácido Domingos Auspizien stehenden »Operalia«-Wettbewerb gewann. Nun war der Weg zu den großen Häusern frei: Bald sang Cura neben dem Weltstar Mirelli Freni den Loris Ipanoff in Umberto Giordanos dekadentem Diven-Melodram Fedora in Chicago. Es folgte die Titelrolle in Stiffelio von Verdi am Londoner Covent Garden. Jüngst debütierte er erfolgreich in der Titelpartie aus Verdis Otello und überzeugte damit auch Zweifler. Vor allem die Helden Giacomo Puccinis nehmen eine zentrale Rolle in Curas Aktivitäten ein. Sie stammen aus Opern voller Melodramatik und Naturalismus. Darin werden sämtliche Kunstmittel in den Dienst des Ausdrucks gestellt. Schöngesang unterliegt hier nicht selten dramatischer Wahrhaftigkeit. Es soll nicht hübsch, sondern überzeugend klingen und unter die Haut gehen. An diesen Partien konnte Cura die Bandbreite seines Könnens beweisen. Bizet, dessen Carmen als Vorläufer dieses Opern-Naturalismus gilt, bot natürlich mit der männlichen Hauptrolle des Don José, der die Prototypin der romantischen Femme Fatale am Ende aus Eifersucht ermordet, eine dankbare Partie für Cura. Er sang den verschmähten spanischen Liebhaber erfolgreich bereits in Los Angeles und San Francisco.
Seine erste Einspielung widmete der mittlerweile mit seiner Familie in Paris lebende Sänger den Helden Puccinis. Unter der Orchesterleitung Plácido Domingos, der sich in den letzten Jahren immer wieder am Dirigentenpult niederließ, nahm er Tenorpartien aus dem Œuvre Giacomo Puccinis auf: Den mutigen Maler Cavaradossi aus Tosca, der einen vor dem Despoten Scarpia fliehenden Freund versteckt und dafür sterben muß; den verzweifelten Löscher Luigi aus Il Tabarro, der in die Frau des Kahnbesitzers Michele verliebt ist; den zwiespältigen amerikanischen Leutnant Pinkerton aus Madame Butterfly, der der jungen Japanerin Cio-Cio-San den Himmel auf Erden verspricht, sie jedoch dann kaltblütig verläßt und zynisch genug ist, mit einer anderen Frau in das Land der Kirschblüte zurückzukehren; den reumütigen Banditen Dick Johnson aus La Fanciulla del West, der in ein kalifornisches Goldgräber-Nest kommt und von seiner couragierten Geliebten vor dem Galgen gerettet wird; schließlich den Prinzen Kalaf, der in Turandot der gleichnamigen chinesischen Prinzessin entschlossen entgegentritt, obwohl sie bislang alle Anwärter töten ließ. Sie sind alle Existenzen in Grenzsituationen, wo extreme Gefühle aufwallen. Dieses Fach ist das richtige Feld für Cura. Denn mit seiner Interpretationskunst zielt er auf die überzeugende Darstellung von Emotionen ab. Darin sieht er die Chance der Kommunikation mit dem Zuschauer von der Opernbühne aus. Einem Journalisten gegenüber äußerte der Sänger: »Es geht auf den Opernbühnen viel zu statisch zu, auch musikalisch. Viele Sänger scheuen sich, Gefühle voll auszuspielen, weil das dem Stil oder der vokalen Linie zuwiderlaufen würde. Das aber ist Unsinn. Oper ist Theater, ist ein Abbild des Lebens. Wenn man eine Frau liebt und sie einem unter den Händen hinwegstirbt, wird man seinen Schmerz herausschreien.«
Dies ist jedoch nur eine Seite des José Cura. 1998 überraschte er die Öffentlichkeit durch seine zweite CD mit dem spanischen Titel Anhelo - und enttäuschte all jene, die erneut einen schmetternden Helden erwartet hatten. Auf dieser Aufnahme befindet sich nicht eine einzige italienische Opernarie, ja überhaupt kein Bravourstück aus dem Opernrepertoire. Hier geht Cura zu seinen Wurzeln zurück. Dabei gibt er sich allerdings keineswegs volkstümlich. Er interpretiert weder Gardel noch schmissige folkloristische Stücke, was Kollegen bei Projekten solcher Art gerne pflegen. Stattdessen widmet sich Cura ausschließlich argentinischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Das Album weist Namen wie Alberto Ginastera und Ariel Ramírez auf. Astor Piazzolla ist mit einer Klavierbearbeitung eines seiner berühmtesten Instrumentalstücke Adiós Nonino vertreten. Dies ist mit rund zehn Minuten der längste Track der Produktion. Ansonsten handelt es sich bei der Anthologie um durchgehend lapidare Kompositionen ohne Pathos, um Gesänge voller Sehnsucht und Melancholie, die teils in stimmungsvolle Orchestrierungen getaucht sind. All diesen Kompositionen sind die überwiegend leisen und empfindsamen Töne gemeinsam. Dies ist beispielsweise der Fall bei der schlichten Romanze La rosa y el sauce von Carlos Guastavino. Aus dessen Feder stammt auch Se equivocó la paloma auf einen Text von Rafael Alberti, bei dessen Orchesterbegleitung das Parfum von Claude Debussy noch nachwirkt. Sowohl elegisch (Canción del carretero) als auch mit einem kindlichen Schalk (Canción de Perico) wird Carlos López Buchardo präsentiert. Zu den eindrucksvollsten Liedern der Einspielung gehören jedoch zweifellos die Werke zweier Komponistinnen, und dies wird hier nicht erwähnt, um irgendeine Quote zu erfüllen: Hilda Herreras Abschiedsgesang Desde el fondo de tí mit Worten von Pablo Neruda beginnt wie eine Hirtenweise gänzlich ohne Begleitung und steigert sich schließlich zu verhaltener Dramatik zu einem Orchesterlied. Ebenso bemerkenswert ist das Strophenlied Postal de guerra von María Elena Walsh mit seiner schwebenden minimalistischen Klavierbegleitung und wohldosierten Orchesterkommentaren.
Auf Anhelo zeigt Cura, daß er nicht nur ein hervorragender Opernsänger, sondern auch ein kreativer und sensibler Liedinterpret ist. Auf vielfältige Weise fühlt er sich in die Stimmungswelt der jeweiligen Werke ein, sei es mit dramatischen Aufschwüngen, sei es mit verinnerlichter Zurückhaltung oder mit einem angerauhten, klagenden Ton. Entsprechend groß ist die Ausdruckspalette und die Wandlungsfähigkeit José Curas. So kann es beim Anhören passieren, daß man häufiger in das Booklet der CD schaut, weil man nicht glaubt, daß es sich um ein und denselben Interpreten handelt. Die von José Cura geschriebenen Lieder auf Sonette von Pablo Neruda, bezwingen durch ihren dichten Ausdrucksgehalt. Sie illustrieren überzeugend sein kompositorisches Credo: »Ich spare nicht mit Gefühlen und Emotionen ... Mir ist die Botschaft wichtig. Meine Musik möchte verstanden werden. Das große Problem der zeitgenössischen Musik heute ist ihre schwere Kommunizierbarkeit«, Es ist abzuwarten, wo die Reise in der Karriere des José Cura hingeht, der auf Anhelo auch als Dirigent in Erscheinung getreten ist. Wenn so der neue Typus des Tenors im 21. Jahrhundert wird, dann brechen in dieser Hinsicht gute Zeiten an; gute Zeiten nicht nur für die Stimmfetischisten, sondern auch für diejenigen, die bereit sind, ihre Ohren für Neues zu öffnen. José Cura hat inzwischen hinreichend bewiesen, daß er nicht nur Stimmbänder und Muskeln hat. Er ist ein Vollblut-Musiker. Deshalb läßt er sich nicht als geistlose Marionette vom Markt bestimmen, dafür ist er zu kreativ. José Cura hat seinen eigenen Kopf. Und darin sind offensichtlich viele Ideen.
Diskographie:
- Puccini Arias, 1997, José Cura, Erato 0630-18838-2
- Anhelo, 1998, José Cura, Erato 3984-23138-2
- Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila, 1998, London Symphony Orchestra & Choir, José Cura, Olga Borodina, Jean-Philippe Lafont, Robert Lloyd Egils Silins, Erato 3984-24756-2