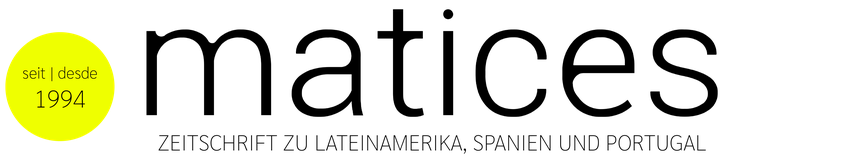Musik zum Überleben
"Klingender Rum" aus Kuba
von Ulli Langenbrinck
Ein Samstagabend im Frühling auf dem Malecón, Havannas Uferpromenade, unterhalb des Hotel 'Nacional'. Eine Art Open-Air-Event auf kubanische Art: Gruppen von Jugendlichen sitzen auf der Mauer, ihre Fahrräder neben sich geparkt, andere schlendern mit ihren Gettoblastern übers Trottoir, übertönt von synkopierten Bläsersätzen aus Autoradios; zwischendrin ein paar Touristen, denen sich Schwarzmarkthändler und jineteras (Gelegenheitsprostituierte) an die Fersen geheftet haben. Hier und da trommeln ein paar Kids auf Blechbüchsen, überall wird ein bißchen getanzt. Die Trommeln werden lauter: eine Gruppe weißgekleideter Menschen hat Kerzen angezündet und wirft Blumen über die Malecónmauer ins Meer, eine Opfergabe für Yemayá, die afrokubanische Meeresgöttin. Plötzlich legt sich ein unwiderstehliches Bass-Riff, gefolgt von klirrenden Bläsersätzen über den verwirrenden Klangdschungel am Malecón - die Cafetería beschallt mit Riesenlautsprechern die abendliche Szenerie. Disco-Stimmung kommt auf, gratis und draußen, fast jeder tanzt nun, allerdings ganz anders, als man es in europäischen Salsakursen lernt : Oberkörper und Beine der Kids bewegen sich in gegenläufigen Rhythmen, zusammengehalten durch kreisende Hüften und akzentuierende Armbewegungen. Jeder hier kennt die Songs der angesagten Bands auswendig, ob von Manolín, dem 'Salsa-Arzt', von der Charanga Habanera, von Paulito y su Élite, von Isaác Delgado, NG La Banda, Los Van Van oder Adalberto Álvarez. Musik ist in Kuba ein Lebensmittel, vielleicht sogar ein Überlebensmittel, und wie nahezu alle lebenswichtigen Dinge ist auch Musik fast ausschließlich gegen Dollars erhältlich. Bei einem Monatseinkommen von rund 15 US-Dollar kann sich allerdings kaum jemand CD’s oder einen Player leisten, nicht mal die Eintrittskarte für Live-Konzerte der angesagten Bands. Bleiben der Malecón, die Autoradios, oder die Cafeteria-Lautsprecher auf der Straße.
Dabei kommen die Songs der kubanischen Kultbands eigentlich von der Straße; häufig karikieren sie mit schwarzem Humor das schwierige Alltagsleben, allgemein ‘la lucha’ genannt, die verschlungenen Wege - allesamt ‘por la izquierda’, also illegal - auf denen die Habaneros an die lebensnotwendigen Dollars kommen. Eine Band wie die kürzlich aufgelöste Charanga Habanera hatte deshalb auch Ärger mit der Zensur bekommen: auf ihrer letzten CD hatte sie einen berühmten Song der spanischen Band Ketama gecovert, in dem es heißt: „Wir sind nicht verrückt / wir wissen, was wir wollen/... Ich lebe gern / und gebe niemandem Erklärungen ab/ Ich bin Bohemien und Träumer... “ ('No estamos locos'). Ein an und für sich harmloser Text, der für die Charanga Habanera allerdings zu mehrmonatigem Auftritts- und Ausreiseverbot führte.
Der König der Danzones
Dabei war Musik in Kuba nie angepaßt. Biß und Witz, Satire und schwarzer Humor haben sich immer schon in der populären Musik ausgedrückt, und viele legendäre Sänger waren nicht nur für ihre Songs, sondern auch für ihren Witz berühmt. Zum Beispiel der 1963 gestorbene Beny Moré, charismatischer Sänger und Komponist, der mit viel Witz und Charme in der Sprache der 'einfachen Leute' schrieb und mit seinen Sones, Mambos und Boleros die populäre kubanische Musik und in der Folge die Salsa beeinflußt hat wie kaum ein anderer Musiker.
Oder die Lecuona Cuban Boys, die in den dreißiger Jahren nach Paris kamen und die Nachtclubszene aufmischten und die europäischen Metropolen ins Rumbafieber versetzten. Afrokubanische Perkussionisten wie Chano Pozo revolutionierten in den vierziger Jahren den US-amerikanischen Bigband-Jazz und verhalfen Dizzy Gillespie zur Entwicklung des Bebop. Oder ‘der Monarch’ Antonio Arcaño, in den dreißiger Jahren König der Danzones. Damals spielte Arcaño mit seinem Orchester Las Maravillas jeden Abend von sieben bis acht Danzones im Radiosender Mil Diez in Havanna, gesponsort von der Seifenfirma GRAVI, für deren Zahnpasta Arcaño nebenbei Reklame machte. Heute mögen sich diese Danzones etwas zittrig und schräg anhören, was an den zahlreichen Geigen liegt, aber damals war der Danzón in den Belle-Epoque-Tanzsälen Havannas der Modetanz. Vor allem die Danzones von Arcaños Band, denn sein Bassist Orestes López hatte den Mittelteil der Danzones verlängert und stärker synkopiert. Das ganze nannte sich Mambo und war die Vorraussetzung für den Chachachá - ganz Nachkriegseuropa schob in den fünfziger Jahren mit 'Vor-Rück-Seit-Ran-Seit' übers Tanzparkett. Die New Yorker Salsa-Szene ließ sich immer schon von kubanischen Rhythmen wie Son, Bolero und Rumba inspirieren, auch und vor allem Willie Colón und Rubén Blades, die Salsa-Heroen der achtziger Jahre.
Die staatliche kubanische Plattenfirma EGREM hat begonnen, diese und andere alten Schätze zu heben und sie meistbietend gegen harte Dollars an ausländische Labels zu verkaufen, was einer der Gründe für das weltweite Revival der kubanischen Musik aus den letzten Jahrzehnten ist. Ein anderer Grund dafür ist die überraschende Tatsache, daß (erst) jetzt auch das internationale Musikbusiness den schier unerschöpflichen musikalischen Reichtum der Insel entdeckt hat. Ob die Mambos und Chachachás der dancing-halls, die melancholischen Boleros gitarrenbewehrter Restaurant-Trios, das geniale spanisch-afrikanische Mischprodukt Son - Kubas Nationalrhythmus, den der Dichter Nicolás Guillén als „klingenden Rum, mit den Ohren zu trinken“ bezeichnete - oder das komplizierte Rhythmengeflecht der in den Sklavenbaracken entstandenen Rumba - all diese Tänze sind in den letzten hundert Jahren auf Kuba entstanden und haben weltweit Karriere gemacht.
„Wann immer ich Jazz, Pop- oder Rockmusik höre, entdecke ich darin etwas aus Kuba,“ meinte der Komponist, Arrangeur und Orchesterchef Mario Bauzá einmal, und hatte recht. Wohl kaum ein anderes Land hat - gemessen an seiner Größe - so gewaltigen Einfluß auf die populäre Musik des 20. Jahrhunderts ausgeübt wie die karibische Zuckerinsel. Ohne die kubanischen Musiker gäbe es weder die New Yorker Salsa-Szene noch den Latin-Rock eines Carlos Santana oder die Popklänge der Miami Sound Machine. Auch wenn die ganze Karibik zu recht als Schmelztiegel gilt - Kuba spielt eine Sonderrolle. Nirgendwo sonst gibt es eine derartige Verschmelzung aus spanischen, französischen, afrikanischen und amerikanischen Elementen, die sich in immer wieder neuen Mischungsverhältnissen verbunden haben und dabei eine ungeheure Vielfalt musikalischer Ausdrucksformen entstehen ließen. Dieser Prozeß ist auch heute nicht beendet: die Kids auf dem Malecón haben absolut nichts gegen Funk, Rap oder HipHop. Im Gegenteil: alle neuen Tendenzen nehmen sie begierig auf, um sie als zusätzliche Steine kreativ in das Mosaik der eigenen Musik einzufügen. Und die weißgekleideten Menschen am Malecón - sind sie eine Ausnahmeerscheinung ?
Keineswegs. Auch die zeremoniellen Rhythmen der afrokubanischen Götter haben längst den Sprung ins Nachtleben geschafft - im kubanischen Alltag sind sie ohnehin allgegenwärtig (santería), mag es der Regierung passen oder nicht. Ein populärer Bandleader wie Adalberto Alvarez outete sich als praktizierender Weissagungspriester (babalawo), so gut wie jede angesagte Band in Havanna hat mindestens einen Hit auf ihren afrokubanischen Lieblingsgott veröffentlicht - meistens ist das Changó, der Herr der Trommeln und der Erotik.
Sicherheitshalber widmete die Band NG La Banda ihren Megahit ‘Santa Palabra’ vor einigen Jahren gleich allen Göttern: „Versteck deine Götter nicht,“ heißt es darin, „trage deine Ketten, kümmere dich nicht darum, was die Leute reden. Die Götter nehmen dir das Schlechte und geben dir Gutes.“
COMPAY SEGUNDO - EIN KUBANISCHER GRIOT
In Spanien wurde er mit der Limousine des Königs herumchauffiert und übernachtete im Palacio de la Magdalena. Eines Nachmittags in Madrid stoppte eine Polizeipatrouille nach einer Verfolgungsjagd mit eingeschaltetem Blaulicht das Taxi, in dem er saß, weil die Polizisten unbedingt ein Autogramm haben wollten. Don Francisco Repilado, genannt ‘Compay Segundo’ nimmt Respektbezeugungen dieser Art wie auch den Jubel des Publikums in der Mailänder Scala, in den renommiertesten Konzerthallen von London, Paris und Amsterdam mit listigem Lächeln und unerschütterlichem karibischen Charme entgegen, ohne je die Ruhe zu verlieren. Den alten Musiker kann so leicht nichts aus der Fassung bringen, schließlich läuft er schon seit knapp 91 Jahren durch die Welt, hat in seiner Heimat Kuba das Karussell der Diktaturen und Aufstände, Hungerzeiten, tropische Hurrikans und die Revolution Fidel Castros erlebt. Musik gemacht hat er, seit er denken kann, denn schließlich wurde er in Santiago geboren, der heimlichen Hauptstadt Kubas und der Wiege des kubanischen Nationalrhythmus Son.
Wer in Santiago geboren wird, läuft, spricht, atmet und tanzt im Rhytmus des Son, sagt man in Kuba. „Der Son ist música mulata - Mulattenmusik, die Verschmelzung von Europa und Afrika in Kuba, in seinen synkopierten Rhythmen spiegelt sich unsere Seele,“ schrieb Kubas bekanntester Dichter Nicolás Guillén. Der Son wird Anfang des Jahrhunderts zum Markenzeichen der kreolischen Kultur, er wandert als Handgepäck umherziehender Zuckerarbeiter von Santiago nach Havanna und erobert in den zwanziger Jahren im Handumdrehen die Kneipen und Tanzhöllen der Hauptstadt. Währenddessen lernt Compay Segundo in Santiago Gitarre und Tres (eine kubanische Variante der Gitarre) und spielt mit 14 Jahren bereits als Profimusiker Klarinette in der städtischen Banda Municipal. Doch am liebsten hockt Compay Segundo in den Musikkneipen neben den legendären Troubadouren der Stadt und begleitet sie mit synkopierten Gitarrenläufen, er lernt von ihnen die hohe Kunst der Improvisation, erfindet unzählige Sones - und bastelt sich 1924 eine besondere Gitarre, das armónico: die Stimmung der sieben (statt sechs) Saiten eröffnet ihm einen sehr individuellen Sound, der die anderen Musiker und das Publikum fasziniert.
Mit dem Son geht auch Compay Segundo von Santiago nach Havanna, wo er in den dreißiger Jahren mit allen berühmten Soneros spielt und die jeweiligen Hauptsänger virtuos als „zweite Stimme“ begleitet. 1949 gründet er mit Lorenzo Hierrezuelo das Duo „Los Compadres“ - zunächst spielen die beiden Reklamesongs für eine Seifenfirma in einem Radiosender, doch schnell avancieren die ‘Compadres’ mit ihren pikanten und poetisch-augenzwinkernden Sones zu Lieblingen der musikbegeisterten Habaneros. Damals übernimmt Compay Segundo seinen Spitznamen „zweite Stimme“ endgültig als Künstlernamen. Nach sechs Jahren trennt sich das Duo und Compay Segundo macht mit eigener Formation weiter, doch große Erfolge kann er nicht mehr feiern - Havanna taumelt im Mambo- und Chachacháfieber, der Diktator Batista zieht die Daumenschrauben an und die Musikmafia verteilt die besten Gigs in der Hauptstadt. Nach der Revolution 1959 arbeitet Compay Segundo jahrelang in einer Tabakfabrik und rollt Tag für Tag seine Lieblingszigarren Montecristo.
Erst in den achtziger Jahren hat er wieder eine eigene Band: „Compay Segundo y sus muchachos“, doch in Havanna haben die traditionellen Boleros und Sones das Etikett „Musik für Großväter“, und bis auf eine Handvoll eingefleischter Son-Fans interessiert sich kaum jemand für Compay Segundo. Das Desinteresse an seiner Musik kommentiert Compay Segundo jedoch ebenso stoisch wie seine fulminante Wiederentdeckung und seinen Riesenerfolg in Europa, den USA und Japan: „Sieben Ellen unter der Erde liegt ein Diamant, und wer ihn herausholt, hat ihn entdeckt. Genau das ist mir passiert.“ Zuerst wurde das spanische Musikbusiness hellhörig, dann kam der amerikanische Gitarrist Ry Cooder. Für das englische Weltmusiklabel World Circuit nahm Cooder drei CD's mit virtuosen alten Musikern aus Havanna auf, die sich bisher eine Million Mal verkauften und den hinreißenden alten Cracks wie Rubén González, Ibrahím Ferrer und Compay Segundo den wohlverdienten Welterfolg sowie einen Grammy bescherten. So könnte es gut und gern noch ein paar Jahrzehnte weitergehen, meint Compay Segundo, schiebt seinen sahneweißen Panamahut zurecht, ohne den man ihn niemals sieht, rollt elegant die Zigarre zwischen den Zähnen hin und her und verrät sein Geheimrezept für bisher 91 Jahre prallvollen Lebens: „Ich denke einfach nie daran, daß ich mal sterben könnte.“