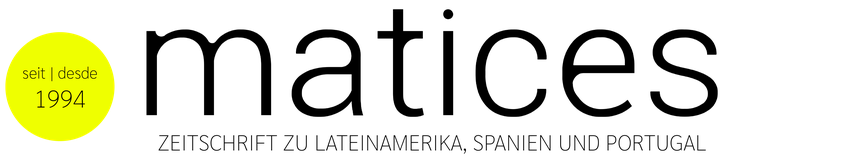Licht am Ende des Plastiktunnels
Die agro-kapitalistische Landwirtschaft um Almería und Huelva
Obst und Gemüse, das man in deutschen Supermärkten kaufen kann, kommt häufig aus den „Plastikmeeren” im Süden Spaniens. Riesige Flächen voller Gewächshäuser, in denen mit möglichst geringen Kosten hohe Erträge erzielt werden sollen. Die Arbeiter*innen sind zu großen Teilen Migrant*innen aus Nordafrika und der Subsahara. Sie leiden besonders unter den prekären Arbeitsbedingungen, organisieren sich teils aber auch in Gewerkschaften.
von Andreas Jünger
Strahlend blauer Himmel, mit Palmen bestückte Strände, prachtvolle maurische Bauten. Überall Speisen und Gerichte, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Das sind wohl die häufigsten Eindrücke, die Reisende aus Andalusien zurück nach Deutschland mitbringen. Nur ein Bruchteil der Urlauber*innen fährt hingegen überhaupt einmal in den Osten der Provinz, abseits der Tourismushochburgen, wo sich am Meer gelegen die Stadt Almería befindet. Bei einer Fahrt über die A-7 von Málaga kommend, rund 20 km vor Almería, bietet sich ein weltweit einmaliger Anblick: Die größte zusammenhängende Plastikgewächshaus-Fläche der Welt, die selbst auf Satellitenaufnahmen aus dem All als weißer Fleck sichtbar ist. Dort werden auf mittlerweile weit über 300 km² Paprika, Tomaten, Zucchini, Gurken, Melonen und vieles mehr kultiviert. Ein Großteil der Ernte landet schließlich in europäischen Supermärkten, insbesondere in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien.
Dieses Gebiet im Süden Spaniens, das häufig nur als „mar de plástico” (Plastikmeer) bezeichnet wird, ist Hotspot und Sinnbild einer in globalen Wertschöpfungsketten eingebetteten und von einer agro-kapitalistischen Produktionsweise bestimmten Landwirtschaft. Hier geht es darum, mit geringen Kosten auf kleiner Fläche möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Kontrast in der Region ist enorm: einerseits große Unternehmen, wie etwa das Transportunternehmen der Brüder Carrión Cáceres mit einem Vermögen von über 300 Millionen Euro, andererseits zehntausende Migrant*innen aus Nordafrika und der Subsahara, die teilweise ohne jegliches Hab und Gut in Spanien eintreffen. Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa schwindet mitunter so schnell wie Eis in der Hitze der Gewächshäuser.
Prädikat „bajo plástico“
Die Region um Almería blickt mittlerweile auf eine über 50-jährige Geschichte als Anbaugebiet für Obst und Gemüse „bajo plástico“ (unter Plastik) zurück. Alles begann im Jahr 1963 mit dem ersten Gewächshaus, das eine Größe von 100 m² besaß. Anfang der 1970er Jahre waren es schon über 10 km², die mit Gewächshäusern bedeckt waren, Mitte der 1980er Jahre über 100 km², Anfang der 2000er Jahre rund 250 km² und heute weit über 300 km². Die Stadt El Ejido, die sich inmitten des Anbaugebietes befindet, spiegelt eine ähnliche Dynamik wieder. Die Zahl der Einwohner*innen stieg von wenigen Tausend Menschen in den 1960er Jahren auf derzeit über 80.000, und die Stadt weist eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen des Landes auf. Die Orte El Ejido und Vícar gehörten um 1900 noch zu den dünnbesiedelsten Ortschaften. Heute liegen sie direkt am oder im „Plastikmeer“ und gehören zu den dichtbesiedelsten Räumen Andalusiens.
Verfall der Lebensmittelpreise, Verfall der Sitten
Paradoxerweise ist der Ausbau der Gewächshausflächen in vielen Fällen nicht dem maßlosen Gewinnstreben der Betreiber*innen zuzuschreiben, sondern einer anderen Entwicklung: Der Kilopreis, den die Produzent*innen im Schnitt für ihre Produkte erhalten, ist in Almería zwischen 1975 und 2010 um über 40 Prozent gesunken. Die Folge waren mehr Gewächshäuser, Intensivanbau, Ertragssteigerung, Einsatz technischer Hilfsmittel und neuer Sorten, Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und Arbeitskräften. Mit der zunehmenden Marktmacht der großen Handelsketten verschärfte sich dieses Problem.
Dass diese große Beschleunigung und Veränderung des gesellschaftlichen Lebens in der Region nicht folgenlos blieben, zeigte sich auf extreme Weise im Februar 2000. Zahlreiche Einwohner*innen von El Ejido nahmen die Ermordung einer jungen Spanierin durch einen Marokkaner zum Anlass für mehrtägige Ausschreitungen gegen Migrant*innen. Hier offenbarte sich erstmals einer breiten Öffentlichkeit weit über die Landesgrenzen hinaus, dass der Gemüsegarten Europas nicht nur glänzende Früchte, sondern auch gesellschaftliche Risse und Ressentiments produziert. In einem gemeinsamen Artikel in der Zeitung El Páis benannten der Schriftsteller Juan Goytisolo und der Philosoph Sami Nair anschließend schonungslos den hinter den Ausschreitungen stehenden Rassismus: „Im demokratischen Spanien des 21. Jahrhunderts werden Unschuldige wegen ihrer sozialen (sie sind arm), konfessionellen (die Mehrheit sind Muslime) und nationalen (sie sind Ausländer) Zugehörigkeit verfolgt.“
Das „rote Gold“ von Huelva
Im Südwesten Andalusiens, in direkter Nachbarschaft zum Naturpark Doñana, befindet sich ein weiteres Anbau Zentrum des internationalen Fruchthandels. In der Nähe der Stadt Huelva wird vor allem Beerenobst kultiviert: Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Auch hier finden sich inzwischen große Flächen mit Plastiktunneln, die dafür sorgen, dass Andalusien in der Liste der größten Erdbeerproduzenten Europas ganz oben steht. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Deutschland etwa 80 Prozent seiner Erdbeerimporte aus der Region Huelva bezieht.
Ähnlich wie in der Region um Almería wurden auch hier schon in den 1960er Jahren die Grundlagen für den späteren Boom des Erdbeeranbaus gelegt. Die Kultur der Erdbeeren konzentrierte sich insbesondere ab den 1980er und 1990er Jahren um kleine Städte wie Moguer, Palos de la Frontera und El Rocío. Vor allem für das mühsame Pflücken der reifen Erdbeeren waren in den letzten Jahren je Saison bis zu 50.000 Arbeiter*innen in Huelva beschäftigt. Die größtenteils weiblichen Beschäftigten stammen vorwiegend aus afrikanischen und osteuropäischen Ländern wie zum Beispiel Marokko, dem Senegal, der Ukraine und Rumänien.
Ausbeutung – a never ending story
Die ökologischen Probleme und sozialen Missstände in den andalusischen Intensiv-Anbaugebieten sind schon lange bekannt: Illegale Brunnen, ein sinkender Grundwasserspiegel, der übermäßige Einsatz von sogenannten Pflanzenschutzmitteln und die Ausbeutung von Arbeiter*innen. Wirft man einen Blick auf einige Überschriften deutschsprachiger Zeitungsbeiträge über die Situation in Almería bzw. Huelva im Laufe der letzten zehn Jahre, wird eine Kontinuität sichtbar: „Wie Sklaven unter Plastik“ (Spiegel, 2007), „Immigranten in Spanien: Selbst als Tagelöhner zu teuer“ (taz, 2010), „Einmal Drecksarbeit und zurück“ (ZEIT, 2015), „Erdbeeren aus Andalusien: Nur bedingt zum Reinbeißen“ (Mallorca Zeitung, 2017). Doch die Tatsache, dass diese Bedingungen, die in Teilen der andalusischen Landwirtschaft herrschen, seit Jahren bekannt sind, hat keineswegs zu einem Wandel geführt. Selbst jene, die angetreten sind, um es anders zu machen, sind mitunter im Blickfeld von Skandalen. Die Rede ist von Bio-Unternehmen, die ihre Produkte mit dem grünen Bio-Siegel in ganz Europa vertreiben.
Aktuelle Recherchen legen skandalöse Zustände offen
Im Jahr 2018 wurden gleich mehrere Rechercheprojekte veröffentlicht, die auf die Situation in den Anbaugebieten um Almería und Huelva eingehen. In einer Kooperationsrecherche von CORRECTIV, dem RTL Nachtjournal und BuzzFeed News machten die Journalistinnen Pascale Müller und Stefania Prandi öffentlich, dass neben der Ausbeutung als Arbeitskraft offensichtlich auch sexuelle Gewalt zum Alltag vieler Arbeiterinnen in der Erdbeerernte um Huelva gehört. Ohne Perspektiven im Heimatland, allein gelassen von lokalen Hilfsorganisationen, abgeschottet in den Plastiktunneln der Erdbeerfelder, kniend und gebückt bei teils unerträglicher Hitze, haben in den vergangenen Jahren viele junge Frauen eine Tortur erfahren, die ihnen nicht mehr als 30 Euro am Tag einbrachte. Aus Gesprächen mit betroffenen Arbeiter*innen sowie durch Nachforschungen in den lokalen Gesundheitszentren konnte die Recherche offenlegen, dass die Zahl der Abtreibungen in den vergangenen Jahren während der Erdbeersaison dramatisch zunahm. Es wird vermutet, dass viele Abtreibungen aufgrund vorheriger Vergewaltigungen durchgeführt werden. Betroffen sind hauptsächlich Migrantinnen, die zur Erdbeerernte angestellt sind.
Auch die Reportage-Reihe „Die Story im Ersten“ zeigte Anfang Juli 2018 einen Beitrag, der sich mit „Europas dreckige[r] Ernte“ befasste. Dabei ergründeten die Macher*innen der Doku speziell die Situation von Geflüchteten in Südspanien und in Süditalien, die in den dortigen Obst- und Gemüsebetrieben als Arbeiter*innen tätig sind. Wie die Aufnahmen der Reportage belegen, sind die Lebens- und Arbeitsumstände von tausenden Migrant*innen im Plastikmeer von Almería auch im Jahr 2018 noch katastrophal. Rund 4.000 Menschen leben in slumartigen Baracken (span. chabolas) nahe des Ortes Níjar, Erntehelfer*innen (häufig Geflüchtete) werden noch vor Morgengrauen von den Chefs an Straßenecken eingesammelt und verdienen zwischen 25-35 Euro am Tag (je nachdem, ob sie Papiere besitzen oder nicht). Der Tariflohn für Erntehelfer*innen liegt hingegen bei rund 47 Euro am Tag. Auch ein Bio-Unternehmen wird gezeigt, dass seinen Beschäftigten zu geringe Löhne zahlte, nicht bezahlte Überstunden verlangte und Festanstellungen verweigerte. Auch das enorme Preisdumping der Supermärkte kommt im Beitrag zur Sprache. Wie in anderen Regionen der Welt, führte es auch in Andalusien bereits zum Selbstmord von Landwirt*innen. Die Chefs vieler betroffener Unternehmen streiten die Vorwürfe ab, lokale Politiker*innen beschönigen offen die Situation und sprechen von „Kampagnen“ gegen Almería. Besonders bitter: Trotz der Verstöße erhalten viele Betriebe EU-Subventionen. Doch der Beitrag zeigt auch einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Arbeiter*innen. Eine kleine Gewerkschaft (SOC-SAT) versucht die betroffenen Menschen über ihre Rechte aufzuklären und mit Aktionen vor Ort gegen die Verfehlungen vorzugehen.
Ausweg: Solidarität!
In Deutschland sehen sich Politiker*innen nicht zuständig für die Geschehnisse, von denen auch deutsche Handelsketten maßgeblich profitieren. Auch Konsument*innen in Deutschland beschweren sich nicht über niedrige Preise, viele sehen sich angesichts der Größe und Komplexität der Globalisierung ohnehin außer Stande, irgendwie korrigierend einzugreifen. Während die Urlaubszentren an der Costa del Sol nur einen Katzensprung von Deutschland mit dem nächsten Ryanair-Flug entfernt scheinen, befinden sich die Anbauzentren unseres Obstes und Gemüses scheinbar in der unendlich weit abgelegenen Peripherie Europas.
Dass es doch anders geht, zeigt etwa der Verein Interbrigadas aus Berlin. In dem seit 2007 existierenden Verein engagieren sich junge Menschen, die seit 2013 regelmäßig Brigaden nach Andalusien entsenden. Interbrigadas ist ein gelungenes Beispiel für die internationale Vernetzung von Arbeitskämpfen. Die Brigadist*innen aus Deutschland unterstützen während ihrer Reise beispielsweise die Gewerkschaft SOC-SAT bei Streiks vor Unternehmen und machen sich vor Ort im Gespräch mit Gewerkschafter*innen und Arbeiter*innen selbst ein Bild der Situation. Auf Grundlage dieser Erfahrungen versuchen sie, Missstände auch in Deutschland publik zu machen, die Proteste zu dokumentieren und in den Supermärkten in Deutschland sichtbar zu machen. Vielleicht fühlt sich manch ein*e Verbraucher*in ja durch die Möglichkeit der direkten Einflussnahme ermutigt, den nächsten Urlaub nicht am Pool auf Mallorca, sondern in einer Brigade in Andalusien zu verbringen.
Andreas Jünger promoviert am Rachel Carson Center for Environment and Society in München. In seinem Promotionsprojekt beschäftigt er sich mit der Geschichte ökologischer Landwirtschaft in Andalusien und untersucht, ob der Öko-Landbau zu einer sozial-ökologischen Transformation des andalusischen Agrarsektors beitragen kann.

„Im demokratischen Spanien des 21. Jahrhunderts werden Unschuldige wegen ihrer sozialen (sie sind arm), konfessionellen (die Mehrheit sind Muslime) und nationalen (sie sind Ausländer) Zugehörigkeit verfolgt.“

Die ökologischen Probleme und sozialen Missstände in den andalusischen Intensiv-Anbaugebieten sind schon lange bekannt: Illegale Brunnen, ein sinkender Grundwasserspiegel, der übermäßige Einsatz von sogenannten Pflanzenschutzmitteln und die Ausbeutung von Arbeiter*innen.