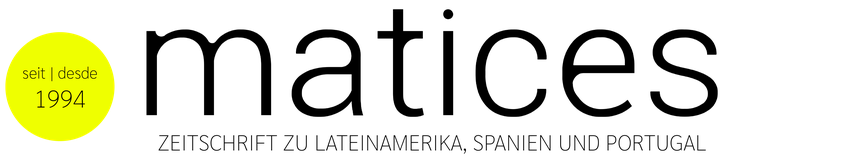Gleiches Recht für alle?
Ein Doppelinterview zum Verhältnis von Indigenenrechten und allgemeinen Menschenrechten
Lateinamerika ist eine Weltregion, in der verschiedene Rechtsordnungen nebeneinander bestehen und auch miteinander in Konflikt geraten. Eine Ebene bildet die der allgemeinen Menschenrechte. Eine andere ist, neben der nationalstaatlichen, die Ebene der regional spezifischen, indigenen Rechtsordnungen. Wie beide in Beziehung zueinander stehen, fragt matices im Gespräch mit dem Kulturanthropologen Dr. Jonas Bens (Teil 1) und der Soziologin Dr. Hannah Bennani (Teil 2).
Interview von Mila Brill
Teil 1: Indigenes Recht in Lateinamerika
Herr Dr. Bens, was sind indigene Gruppen?
Wenn man das Wort „indigen“ ins Deutsche übersetzt, heißt das so etwas wie „heimisch.“ Auf Lateinamerika bezogen bezeichnet man als Indigene diejenigen, die schon vor Ankunft der Europäer die Amerikas bewohnt haben. Der Begriff ist relativ neu, und wird etwa seit den 1980er Jahren im internationalen Recht verwendet. Das spanische Wort indio wird heute von vielen Indigenen als herabwertender Ausdruck abgelehnt. Es stammt noch aus der frühen Kolonialzeit, und hat seinen Ursprung darin, dass die europäischen Eroberer zunächst dachten, Indien erreicht zu haben. Um sich selbst zu beschreiben benutzen indigene Gruppen ihre eigenen Namen, zum Beispiel Yanomami oder Aymara.
Mitte April wurde in Peru Olivia Arévalo, Aktivistin und Heilerin der Shipibo-Konibo, erschossen. Internationale Medienaufmerksamkeit bekam der Fall, als ein Kanadier, der den Mord an Arévaio begangen haben soll, daraufhin ermordet wurde. Im Guardian wird der Präsident des indigenen Rates der Shipibo-Konibo und Xetebo zitiert, die Täter des Lynchmordes hätten sich des „traditionellen Rechts“ bedient, die Shipibo-Konibo seien aber grundsätzlich ein „friedfertiges, in Harmonie mit der Natur lebendes Volk“. Sind hier nationales und indigenes Recht in Konflikt geraten?
Ja, dieser extreme Fall verweist im Kern auf einen Konflikt zwischen zwei Rechtsordnungen, die parallel existieren. In der Anthropologie nennt man das Rechtspluralismus. Viele Rechtsordnungen nichtstaatlicher Gesellschaften erlauben die private Vergeltung. Staatliche Rechtsordnungen, die auf dem Prinzip des Gewaltmonopols des Staates aufbauen, verbieten die Privatstrafe hingegen streng. In einem solchen Fall kann das, was in der indigenen Rechtsordnung legal ist, in der nationalen Rechtsordnung ein Verbrechen sein.
Indigenen Gruppen werden zunehmend auch als Einheit kollektive Rechte zugesprochen. Wie kommt das in Lateinamerika zur Anwendung?
Im Grunde ist es so: Indigene Rechtsordnungen existieren, wenn sie von den indigenen Gemeinschaften gelebt werden. Ob sie nun geschrieben oder ungeschrieben sind, ist dabei nicht entscheidend. Aber natürlich ist es in der Praxis wichtig, ob das nationale oder internationale Recht diese Rechtsordnungen auch anerkennen. In diesem Falle sagen die Staaten: Dieses und jenes überlassen wir zur Regelung dem indigenen Recht. Aus der Perspektive des Nationalstaats sind das dann kollektive Rechte. Für die indigenen Gemeinschaften gilt aber einfach ihr Recht, ohne dass der Staat seine Regeln gegen ihren Willen durchsetzt. So ergibt sich ein ständiger Verhandlungsprozess zwischen den indigenen Gemeinschaften und den Staaten, in denen sie leben. Seit den späten 1990er Jahren haben indigene Bewegungen in Lateinamerika einige neue rechtliche Instrumente in den Staaten der Region durchgesetzt. Die wichtigsten sind Landtitel, die ihrem Territorium einen mehr oder weniger festen Status in der nationalen Rechtsordnung einräumen, und Mitspracherechte bei der Vergabe von Lizenzen an Unternehmen, die auf ihrem Land natürliche Ressourcen ausbeuten wollen.
Wird die Anerkennung indigener Rechte allgemein in Lateinamerika denn praktisch umgesetzt?
Viele sozialwissenschaftliche Studien, insbesondere von Sozial- und Kulturanthropolog*innen, zeigen, dass sich durch die veränderte Rechtslage und stärkere indigene Rechte in den Nationalstaaten die wirtschaftliche und soziale Lage von indigenen Gruppen oft kaum verbessert. Der Teufel steckt nämlich im Detail. Diejenigen, denen das Land gehört, entscheiden noch nicht unbedingt verbindlich, ob dort zum Beispiel Gold oder Erdöl abgebaut werden darf und von wem. Selbst wenn die indigenen Gruppen Mitspracherechte bei Konzessionsvergaben für Privatunternehmen haben, können sie damit solche Konzessionen nicht unbedingt auch blockieren. Und oft haben die indigenen Gruppen keinen rechtlichen Anspruch darauf, am Gewinn solcher Ressourcenextraktion beteiligt zu werden. Hinzu kommt auch, dass die Staaten nicht selten Rechte einräumen, sie dann aber in der Praxis zu unterlaufen versuchen. Die neuen Regime indigener Rechte können nicht so einfach das über Jahrhunderte verfestigte System wirtschaftlicher Ungleichheiten umwälzen. Die Euphorie der frühen 2000er Jahre zum Thema indigene Rechte ist also inzwischen auch oft der Ernüchterung gewichen.
Welche Schritte sind Ihrer Meinung nach noch nötig, um indigenen Rechten einen angemessenen Platz im nationalen und internationalen Recht zu verschaffen?
Ich finde es sehr wichtig zu verstehen, dass rechtliche Ansätze kein Patentrezept sind. Internationale und nationale Regime zur Anerkennung indigener Rechtsordnungen sind wichtig, weil sie helfen können, die Abwägung der Interessen zwischen dem Staat und den indigenen Gemeinschaften etwas auszugleichen. Aber die Interessengegensätze bleiben bestehen und lassen sich nicht durch rechtliche Regelungen aus der Welt schaffen. Starke Landrechte sind und bleiben im Zentrum dessen, was indigene Bewegungen durchsetzen wollen, um gegenüber dem Staat möglichst viel Macht darüber zu haben, was auf ihrem Territorium passiert – wirtschaftlich, sozial und kulturell. Aber solange indigene Gemeinschaften keine eigenen Staaten sind, sondern innerhalb von Nationalstaaten leben, werden sie sich nie zu einhundert Prozent mit ihren Interessen gegen den Staat durchsetzen. Einfach gesagt: die anderen Bürger dieses Staates haben eben auch Rechte (z.B. auf Ressourcen), die sie durchsetzen wollen. Dieser ständige Aushandlungsprozess ist im Kern politisch und dreht sich um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ungleichheiten. Es wird der Debatte um indigene Rechte nicht schaden, das im Auge zu behalten.
Teil 2: Kollektivrechte und die allgemeinen Menschenrechte
Frau Dr. Bennani, spricht man über Menschenrechte ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, einschließlich ihrer Ergänzungen und Erweiterungen, gemeint. Wie ist diese Erklärung entstanden?
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) wurde 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und ist ein Produkt der Nachkriegszeit. Man wollte damals eine verbindliche Werteordnung schaffen. Die Erklärung deckt ein weites Spektrum von Rechten ab, neben klassischen Rechten auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder freie Meinungsäußerung, auch soziale Rechte wie etwa das Recht auf Bildung. Die Besonderheit der Erklärung ist, dass sie die Rechte aller Menschen formuliert – unabhängig von bestimmten Merkmalen, die zur Grundlage von Diskriminierungen wurden (und immer noch werden). Ausdrücklich genannt werden zum Beispiel „Geschlecht“, „Rasse“, „Hautfarbe“, aber auch der Status des Gebietes, in dem ein Mensch lebt. Damit wurde die Bevölkerung von Kolonien und Protektoraten explizit in den Kreis der Träger*innen der Menschenrechte eingeschlossen. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass der Kreis der Verfasser*innen der Allgemeinen Erklärung ein sehr partikularer war: Ein Großteil der Welt befand sich noch in formaler Abhängigkeit und war von den Verhandlungen ausgeschlossen. Das gilt auch für Repräsentant*innen indigener Völker.
Den Allgemeinen Menschenrechten werden auch Ethnozentrismus und die Fokussierung auf „westliche Werte“ vorgeworfen. Wie allgemein sind die Menschenrechte?
Die Menschenrechte der AEMR spiegeln meiner Meinung nach ein auf das Individuum zentriertes Rechtsverständnis, das westlicher Herkunft ist und als Korrelat zu einer bestimmten Gesellschaftsform – der funktional differenzierten Gesellschaft – verstanden werden kann. Das Vorbild für den „Mensch der frühen Menschenrechte“ war dabei der weiße, erwachsene, gesunde, vernunftbegabte Mann und Familienvater.
Man kann sicher sagen, dass die Menschenrechte im Laufe der letzten Jahrzehnte „allgemeiner“ geworden sind. Denn gerade jene Gruppen von Personen, denen der Status als „vollwertiger Mensch“ aberkannt worden ist, haben sich organisiert und konnten auf die politischen Prozesse der Ausformulierung von Menschenrechten Einfluss nehmen. Das begann mit einer breiten Skandalisierung von Rassismus in den 1960er Jahren, betrifft aber auch Frauen, Menschen mit Behinderung oder eben indigene Völker. So hat sich der Kanon der Menschenrechte diversifiziert. Gleichzeitig erweisen sich Menschenrechte durchaus als anschlussfähig an nicht-westliche Konzeptionen von sozialer Gerechtigkeit. Ich denke, ein pauschaler Vorwurf des Ethnozentrismus greift zu kurz. Er wird zudem der Tatsache nicht gerecht, dass zahlreiche nicht-westliche Aktivist*innen und Akademiker*innen Menschenrechte als adäquate Sprache erachten, um ihre Position zu formulieren. Auch wenn sie ganz klar auf das Paradox hinweisen, dass die Protagonisten der Aufklärung Menschenrechte proklamierten und gleichzeitig massive Menschenrechtsverletzungen in der außereuropäischen Welt legitimierten. Zugleich müssen wir natürlich die Frage im Blick behalten, wer sich wann wie auf „Menschenrechte“ bezieht. Gerade in jüngerer Zeit ist zu beobachten, wie ein Rekurs auf „westliche Werte“ eine ganz unheilvolle Allianz mit rassistischen Denkmustern eingeht.
Verändern sich Menschenrechte langfristig?
Definitiv. Menschenrechte sind keine universellen Werte, die irgendwo in der Luft schwirren, sondern soziale Institutionen, Gegenstand von Aushandlungen und sozialen Kämpfen. Sie können nur ihre Wirkung entfalten, wenn an sie kommunikativ angeschlossen wird. Hier ist ein enormer Bedeutungsgewinn seit den 1970er Jahren zu beobachten, als Menschenrechte sich als Bezugspunkt und Formel für soziale Gerechtigkeit zu etablieren begannen.
Aber auch inhaltlich sind Menschenrechte im stetigen Wandel. Wir können von einer Differenzierung und Pluralisierung der menschenrechtlichen Inhalte sprechen. Ein zentraler Motor, das habe ich schon angedeutet, waren hier soziale Bewegungen. Indigenenrechte sind dafür ein gutes Beispiel.
Inwiefern werden Rechte von indigenen Gruppen in die Menschenrechte eingebunden?
2007 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Erklärung über die Rechte indigener Völker angenommen. Vorangegangen ist ein Jahrzehnte währender, sehr kontroverser Verhandlungsprozess, an dem indigene Aktivist*innen aus aller Welt beteiligt waren. Durch die Erklärung haben die Indigenenrechte einen Platz im Kanon der Menschenrechte, auch wenn es sich nicht um einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag wie etwa die Frauenrechtskonvention handelt. Inhaltlich hat die Erklärung über die Rechte indigener Völker einen besonderen Status, weil sie nicht nur die Rechte indigener Individuen proklamiert, sondern indigene Völker als kollektive Rechtsträger anerkennt. Das ist wirklich etwas Besonderes, gerade wenn man sich die individualistische Ausrichtung des Menschenrechtsregimes vor Augen führt.
Die Deklaration schließt an die zentralen Prinzipien des Menschenrechtsdiskurses an und betont Gleichheitsgebot und Diskriminierungsverbot. Die Erklärung spiegelt aber auch weitreichende Reinterpretationen etablierter Rechte wieder, die den Besonderheiten indigener Völker Rechnung tragen. Das Recht auf Gesundheit umfasst beispielsweise nicht nur den Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem, sondern auch das Recht auf die Beibehaltung indigener Arzneimittel und medizinischer Praktiken, was zum Beispiel auch den Schutz von Heilpflanzen betrifft. Gleichzeitig führt die Deklaration auch Rechtsinhalte auf, die sich so sonst nirgendwo finden, etwa das (kollektive) Recht auf die Aufrechterhaltung eigener politischer, rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Institutionen oder die Landrechte.
Landrechte spielen für indigene Gruppen eine entscheidende Rolle. Lassen sich starke territoriale Gruppenrechte mit nationalem und internationalem Recht verbinden? Welche Risiken und Chancen sehen Sie?
Kollektive Rechtsansprüche – also Landrechte, aber auch das Recht auf eigene Institutionen oder auf Selbstbestimmung – irritieren das übliche Menschenrechtsdenken. Klassisch betreffen Menschenrechte eine Rechtsbeziehung zwischen Individuum und Staat, das sind die „Rechtsträger“ bzw. „Rechtsadressaten“. Wenn nun subnationale Kollektive als eigene Rechtssubjekte oder gar Träger von spezifischen Rechten Anerkennung finden, gerät ein etabliertes Gefüge durcheinander. Kollektivrechte werden dann auf der einen Seite als Bedrohung nationalstaatlicher Souveränität gesehen – gerade mit Blick auf das Recht auf Selbstbestimmung der Völker. Auf der anderen Seite lässt sich kritisch fragen, ob Kollektivrechte nicht dem Gleichheitsgebot widersprechen und auch als Gefahr für individuelle Menschenrechte gesehen werden können – etwa wenn indigene Institutionen dem Gebot der Geschlechtergleichheit widersprechen.
Trotzdem sehe ich die Anerkennung indigener Kollektivrechte als eine produktive Weiterentwicklung des Menschenrechtsdiskurses. Ich finde, es stehen gute Antworten auf die oben aufgeworfenen Fragen zur Verfügung: So macht die Deklaration über die Rechte indigener Völker das Prinzip des „free, prior, informed consent“ stark, das sozusagen als Scharnier zwischen indigenen Individuen, indigenem Volk und Staat dient. Dieses besagt, dass es einer Zustimmung indigener Völker zu staatlichen Entscheidungen bedarf, die diese direkt betreffen, wie etwa den Abbau von Ressourcen. Auch wenn die Umsetzung weit hinter dem Anspruch zurück bleibt, zeigt das Beispiel der kollektiven Rechte indigener Völker die Dynamik des zeitgenössischen Menschenrechtsdenkens. Menschenrechte sind vielfältiger, auch widersprüchlicher, und ein bisschen „allgemeiner“ geworden.
Dr. Jonas Bens ist Jurist und Kulturanthropologe und arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie der Freien Universität Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Rechtsanthropologie und die Politische Anthropologie. Demnächst erscheint sein Buch The Indigenous Paradox: Rights, Sovereignty, and Culture in the Americas bei The University of Pennsylvania Press.
Dr. Hannah Bennani ist Soziologin und arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Eberhard Karls Universität Tübingen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Soziologie der Humandifferenzierungen, Soziologie der Menschenrechte und Weltgesellschaftstheorie. Ihr Buch Die Einheit der Vielfalt. Zur Institutionalisierung der globalen Kategorie „indigene Völker“ ist 2017 bei Campus erschienen.